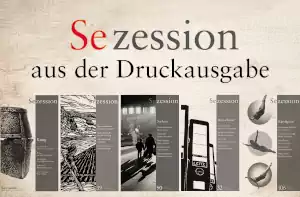Neben der Massenmigration, der Energiewendepolitik und der LGBTQ-Agenda ist der Vegetarismus / Veganismus eines der missionarisch aufgeladenen, von globalen Eliten eifrig angekurbelten Universalprojekte unserer Zeit.
Die massive Reduzierung des weltweiten Fleischkonsums, die den Ausstoß klimaschädlicher Gase verringern und die Aufheizung der Erde eindämmen soll, nimmt unter den Nachhaltigkeitszielen der diversen supranationalen Organisationen eine hervorgehobene Stellung ein. Längst geben sich auch die deutschen Grünen nicht mehr mit einem Veggieday pro Woche zufrieden.
In einem Positionspapier vom 30. August 2022 stellte die grüne Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft fest, daß »Ernährung keine Privatsache mehr« sei und daß neben die Energiewende eine »Ernährungswende« treten müsse. Um sicherzustellen, daß der Verzehr von Eiern, Fleisch und Milchprodukten möglichst zeitnah um 75 Prozent zurückgeht, sollen Mensen, Kantinen und Weihnachtmärkte über Quotenregelungen verpflichtet werden, vorwiegend pflanzliche Kost bzw. fleischfreie Nahrung anzubieten. (1)
Dabei gibt es durchaus gute und stichhaltige Gründe, die Fleischproduktion zurückzuschneiden: Denn die Haltungs‑, Transport- und Schlachtungsverfahren, derer sich die intensivierte Viehwirtschaft bedient, sind längst industriell fabrikmäßig durchgetaktet und bewirken eine rücksichtslose Vernutzung tierisch-kreatürlichen Lebens. Und doch besitzt der großangelegte, von mächtigen Einflußgruppen beworbene und abverlangte Vegetarismus / Veganismus noch eine weiter gehende, größere gesellschaftlich-politische Dimension.
Was aber besagt es über unsere Epoche als geschichtliche Situation, daß sie die Menschen der fleischlichen Nahrung zu entwöhnen und im großen Stil auf eine fleischlose, vegetarische / vegane Diät hinzulenken versucht? Was steht über die Beschaffenheit und den Charakter einer künftigen Welt zu vermuten, in der der Neue Mensch sich pflanzlich ernährt, um Körper und Seele zu heilen und den Planeten Erde zu retten, während der Fleischesser als der Alte Mensch für Leid und Umweltzerstörung verantwortlich zeichnet? Um diesen Fragen nachzugehen, wird zunächst ein kurzer Abriß der Geschichte des Vegetarismus / Veganismus gegeben.
Die Geschichte des Vegetarismus im Westen beginnt mit dem Vorsokratiker Pythagoras (ca. 570 – 510 v. Chr.) und der von ihm initiierten Schule der Pythagoreer. Als erster europäischer Denker vertritt Pythagoras die Theorie der Reinkarnation, wonach die Seele nach dem Tode in tierischer oder menschlicher Verkörperung eine neue physisch-materielle Gestalt annimmt. Wer Tiere tötet und verzehrt, mordet eine menschliche Seele, die in einem Tierkörper Zuflucht gesucht hat, und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Kannibalen. Pythagoras zufolge stellt der Kosmos eine alles Lebendige verbindende, nach mathematischen Gesetzen aufgebaute und geordnete, universal zusammenklingende Einheit dar.
Auch die menschliche Lebenswelt ist demnach nicht durch demokratische Diskurse und Entscheidungsprozesse der Polisbürger, sondern durch eine wissenschaftlich präzise Anwendung der richtigen Zahlenverhältnisse einzurichten. Das strenge, pythagoreische Verbot des Verzehrs nicht nur von Fleisch, sondern auch von Bohnen geht nach Spencer auf den Umstand zurück, »daß die Bohne bei Abstimmungen als Wahlmarke in Gebrauch war. Sich des Verzehrs von Bohnen zu enthalten bezeichnete insofern zugleich die Absicht, sich auch der Politik konsequent zu enthalten.« (2)
Epikur (341 – 271 v. Chr.) ist der Philosoph der Seelenruhe, der inneren Freiheit und der Selbstgenügsamkeit. Statt auf äußere Ehren oder Reichtümer kommt es ihm allein auf das individuelle Bewußtsein, die persönlichen Empfindungen an. Als höchste Lust gilt ihm ein Leben, das weitgehend frei von körperlichen Schmerzen und seelischen Beunruhigungen bleibt. Dabei ist der einzelne nicht wie im klassischen griechischen Staatsverständnis der Polis untergeordnet und auf deren Zwecke und Anforderungen ausgerichtet, sondern in erster Linie als autonomes Subjekt konstituiert. Epikur zieht sich aus der Stadt in den »Garten« zurück, um abseits des Getriebes ein »Leben im Verborgenen« im Kreise von Freunden zu führen, die sich der Staatsgeschäfte bewußt enthalten. Dort hält man eine magere, pflanzlich-natürliche Diät aus Cerealien, Brot, Gemüse, Nüssen, Wasser und Obst, die die Leidenschaften dämpft und der Selbstbescheidung förderlich ist.
Ovid und der Dichterkreis des frühen Kaiserreiches preisen das Ideal eines einfachen Liebes- und Lebensglücks in idyllischer, heilsamer Natur, wo individuelle Freiheit und erotische Erfüllung mehr als der altrömische, rigide mos maiorum gelten. Nach dem Untergang der Republik und der Errichtung des Prinzipats hört das öffentlich-politische Leben auf, die Energien der Bürger zu absorbieren; das alte Primat eines Lebens im Dienste des Staates entfällt; an seine Stelle treten die Vergnügungen der »Ars amatoria«. Aus Mythen und Sagen schöpfend, erwächst unter dem Schirm des Augustus ein Goldenes Zeitalter, das der Liebe, den Musen und der Kunst gewidmet ist.
In dieser Ära der Humanität, der Zivilisation und des universalen Friedens ist kein Platz mehr für das Töten und Verspeisen der Mitgeschöpfe, die der Mordlust und den Kriegen zugrunde liegen: »Laßt, ihr Sterblichen ab, durch frevlige Speise die Leiber euch zu entweihen. […] Gaben in Fülle beschert die verschwenderische Erde zu milder Natur und Kost, die Blut nicht heischet und Tötung. Welch ein vermessenes Tun im Fleische das Fleisch zu versenken und den begehrlichen Leib mit verschlungenem Leibe zu mästen.« (3)
Die Katharer sind die bedeutendste Ketzerbewegung des Mittelalters, die sich zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert vor allem in Südfrankreich, aber auch in Norditalien vorübergehend etabliert. Sie vertreten einen radikalen Dualismus, der alles Irdisch-Materielle für unrein erachtet. Während das Reich des Geistig-Intelligiblen von einem gütigen Schöpfergott erschaffen wurde, hat sich ein böses Prinzip in die körperlich-materielle Welt gegossen. Die Katharer lehnen die Welt, ihre Einrichtungen (Eigentum, Ehe, Staat) und alle irdischen Vergnügungen ab. Statt an der Welt teilhaben zu wollen, nimmt man eine passiv-feindselige Haltung ihr gegenüber ein und zieht sich in ein Leben in Armut zurück, das dem Gebet, der Askese und der Forderung gewidmet ist, den »Erwählten« oder »Vollkommenen« unbedingten Gehorsam zu leisten.
Zentral ist die Ablehnung der Sexualität, kommt durch die Zeugung doch eine neue Körperlichkeit und Materialität in die Welt. Daraus leiten sich strenge Speisevorschriften ab: Fleischliche Nahrung sowie überhaupt alles, was von der Fortpflanzung und Verbindung der Geschlechter herrührt, ist konsequent zu meiden. Jedes Mal, wenn der Mensch fleischliche Nahrung zu sich nimmt, verstärkt er die körperlich-materiellen Anteile in sich und wirkt seiner intrinsischen Bestimmung entgegen, sich aus der Gefangenschaft der Materie in das Reich der Geistigkeit (Immaterialität und Körperlosigkeit) zu erheben.
Die Fabian Society ist die einflußreichste politisch-intellektuelle Denkfabrik im spät- und nachviktorianischen England; sie vertritt eine autoritäre Version des Sozialismus von oben, der nicht an die Selbstorganisation der Massen appelliert, sondern von einer expertokratischen Elite geleitet werden soll, die an die wissenschaftliche Methode glaubt. George Bernard Shaw, die herausragende Gestalt der Fabier, vertraut nicht dem parlamentarischen System, das er als eine Veranstaltung der Phraseologie und des leeren Geredes abtut.
Statt des Klassenkampfes und der Revolution von unten im Marxschen Sinne soll es den starken, zu Übermenschen verklärten Persönlichkeiten obliegen, den Staat nach Grundsätzen der Rationalität zu lenken und ein Zeitalter der Gewaltlosigkeit einzuläuten, das sich der fleischlichen Nahrung enthält. Erst eine vegetarisch / vegan gewordene Zivilisation wird jenes Reich der Moderation, der Verständigkeit und der wohlgeordneten, friedlichen Zusammenarbeit entstehen lassen, das der politisch gewendete Puritanismus Shaws und der Fabier imaginiert.
In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wird der Monte Verità zum Siedlungs- und Wallfahrtsort für Lebensreformer und »Naturmenschen« aus allen Teilen Europas. Das freiere, gesündere, naturnahe, spirituelle Leben, das die Aussteiger erstreben, umfaßt insbesondere eine streng »vegetabile« Ernährung. Das »nur dem Augenblick geweihte, selbstgenügsame Leben« der »Verkünder einer neuen Zeit« koppelt sich von der Vorstellung ab, Teil eines politisch agierenden Verbandes zu sein. Das Dasein in ursprünglicher Sinnlichkeit und Nacktheit ist ahistorisch-apolitisch als eine Existenz ohne Gesetze, politische Körperschaften oder Autoritäten angelegt.
Der Fokus auf das subjektive Bewußtsein, die persönliche Autonomie und ein Leben in Übereinstimmung mit sich selbst bietet keinen Raum mehr für die alten, gemeinschaftsbildenden Zusammenhänge des Staates und der Nation. Dabei wirkt sich der radikale Individualismus bis in die Speisepraxis aus: »Neben der Reduzierung des Zubereitungsaufwands bietet die vegetarische bzw. vegane Küche noch einen weiteren großen Vorteil: die Möglichkeit der Individualisierung der Nahrungsaufnahme. Schlichter gesagt, gemeinsame Mahlzeiten werden überflüssig. Wo Kochen nicht mehr heißt, komplexe Menüfolgen zu komponieren, und Essen nicht mehr darin besteht, diese in vorgesetzter Zusammensetzung und Reihenfolge zu konsumieren, entfällt auch die Notwendigkeit, zur selben Zeit am selben Tisch zu sitzen.« (4)
In Mensch und Technik (1931) notiert Oswald Spengler über den Unterschied zwischen den pflanzenfressenden und den fleischfressenden Tieren: »Ein Pflanzenfresser ist seinem Schicksal nach ein Beutetier und sucht sich diesem Verhängnis durch kampflose Flucht zu entziehen. Ein Raubtier macht Beute. Das eine Leben ist in seinem innersten Wesen defensiv, das andere ist offensiv […]. Die höheren Pflanzenfresser werden neben dem Gehör vor allem durch die Witterung beherrscht, die höheren Raubtiere aber herrschen durch das Auge. Die Witterung ist der eigentliche Sinn der Verteidigung. Das Auge der Raubtiere aber gibt ein Ziel. Schon dadurch, daß die Augenpaare der großen Raubtiere wie beim Menschen auf einen Punkt der Umgebung fixiert werden können, gelingt es, das Beutetier zu bannen. […] Das Weltbild ist die vom Auge beherrschte Umwelt. Ein unendliches Machtgefühl liegt in diesem weiten ruhigen Blick.« (5)
Nun wäre es mit Sicherheit zu einfach, aus den Spenglerschen Unterscheidungen zu schließen, daß die Karnivoren unter den Menschen berufen sind, Herrschaft auszuüben, während es den Herbivoren zukommt, sich zu unterwerfen und beherrschen zu lassen. Und doch fällt auf, daß die geschichtlich hervorgetretenen Großvorhaben des Vegetarismus / Veganismus ein durchgängig politikfernes Moment aufweisen. Sie wenden sich von den Einrichtungen des bürgerschaftlich verfaßten Staates explizit ab. Ihnen mangelt die Bereitschaft, sich im Modus des Politischen aktiv bejahend auf die Welt zu beziehen.
Statt dieser als sprechend und handelnd zusammenwirkendes Kollektiv den Stempel aufdrücken und das Gesetz vorschreiben zu wollen, neigen sie dazu, sich aus der Welt zurückzuziehen und eine verneinende Haltung ihr gegenüber einzunehmen. Ihnen geht es weniger darum, Macht zu entfalten, die aus dem Zusammenwirken der Bürger im öffentlich-politischen Raum entsteht, um sich in der Realität der Welt zu behaupten und sie formativ zu gestalten. Sie verstehen sich dezidiert nicht als eine politische, in der überlieferten (staatlich-volklichen) Geschichte stehende und handelnde Einheit.
In der Tat deutet vieles darauf hin, daß zwischen der Praxis des Fleischverzehrs und der Herausbildung eines genuin politischen Raumes ein enger Konnex besteht. Mit Blick auf die steinzeitlichen Jäger- und Sammlergesellschaften stellt Colin Spencer fest, daß »der Verzehr von Fleisch eine Konvention, ein Teil der Struktur des gesellschaftlichen Lebens wurde, an die Spitze der Verzehrpraxis trat und als feierlich begangene Mahlzeit von Dogmen und Ritualen umgeben war. […] Jäger- und Sammlergesellschaften teilen durchweg das Fleisch mit allen Mitgliedern der Gruppe, nicht jedoch die pflanzliche Nahrung, die anscheinend nur von denjenigen verzehrt wird, die sie auch gesammelt haben.« (6)
Der kollektive Verzehr von Fleisch ist demnach für die Bildung einer politischen Gemeinschaft konstitutiv. Der steinzeitliche Jäger- und Sammlerverband, der am Feuer zusammenkommt und das gemeinsam gejagte Tier verzehrt, ist gewissermaßen die Urform der Polis. Die Sorge um den Zusammenhalt der Gruppe, die Aussprache über ihre Belange, die Gewährung von Schutz, die Etablierung gemeinschaftsbildender Kulturpraktiken, die Ausbildung von Hierarchien und die Formierung kollektiver Macht hängen unmittelbar mit der Zuteilung der Ressource Fleisch (als Ursituation) zusammen. Die kollektiv-programmatische Abkehr vom Fleischkonsum stellt insofern einen subversiven Angriff auf den Bestand des Politischen, der Staatlichkeit überhaupt dar.
Die heutige, großangelegte Hinlenkung auf den Vegetarismus / Veganismus repräsentiert ein Indiz, daß die Kraft der überlieferten politischen Vergemeinschaftung schwindet. Sie deutet darauf hin, daß der Staat als Format der bürgerschaftlichen Selbstregierung durch Aussprache, Diskurs und Unterredung an Autorität verliert. Das Weltbild des Vegetarismus / Veganismus geht seit jeher von einer (kosmischen) Verflochtenheit alles Lebendigen aus. Dieses bildet eine harmonische Einheit, in der für einzelne, ethnisch-territorial begrenzte, ihre Geschicke im Wege der Unterredung aushandelnde Sondergemeinschaften kein Bedarf mehr besteht. Insofern in der Denkungsart des Vegetarismus / Veganismus alle beseelten Lebewesen Teil eines friedlich einträchtigen Ganzen sind, entfällt jene elementare Unterscheidung zwischen Freund und Feind, ohne die nach Carl Schmitt der Begriff und die Sphäre des Politischen keinen Sinn ergeben.
In diesem Zusammenhang wichtig ist zudem der Hinweis Spenglers auf die spezifische, »perspektivische« Form des Weltbezugs, die aus der für die fleischfressenden Tiere typischen »Art des Sehens« erwächst: »Das Fixieren der nach vorn und parallel gerichteten Augen ist aber gleichbedeutend mit dem Entstehen der Welt in dem Sinne, wie der Mensch sie hat, als Welt vor seinen Blicken, als Welt nicht nur des Lichts und der Farben, sondern vor allem der perspektivischen Entfernung, des Raumes und der in ihm stattfindenden Bewegung. […] Pflanzenfresser, z. B. Huftiere, haben dagegen seitwärts gerichtete Augen, von denen jedes einen anderen, unperspektivischen Eindruck hat.« (7)
Auf die entscheidende Bedeutung der Perspektive für die Konstitution eines öffentlichen Raumes weist auch Hannah Arendt in ihrem theoretischen Hauptwerk Vita activa oder Vom tätigen Leben hin: Arendt hebt auf die Pluralität der Anschauungen ab, ohne die ein politischer Raum sui generis sich nicht bilden kann. Ein öffentlicher Diskurs kann nur entstehen, wenn die Menschen die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und folglich genötigt sind, sich handelnd und sprechend über die Wirklichkeit der gemeinsamen Welt zu verständigen: »Die Wirklichkeit des öffentlichen Raumes erwächst aus der gleichzeitigen Anwesenheit zahlloser Aspekte und Perspektiven, in denen ein Gemeinsames sich präsentiert, und für die es keinen gemeinsamen Maßstab und keinen Generalnenner je geben kann. […] Nur wo Dinge, ohne ihre Identität zu verlieren, von Vielen in einer Vielfalt von Perspektiven erblickt werden, so daß die um sie Versammelten wissen, daß ein Selbes sich ihnen in äußerster Verschiedenheit darbietet, kann weltliche Wirklichkeit eigentlich und zuverlässig in Erscheinung treten. […] Eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird; sie existiert überhaupt nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven.« (8)
So kommt es nicht von ungefähr, daß die geschichtlich wirksam gewordenen Kollektiverscheinungen des Vegetarismus / Veganismus explizit unperspektivisch angelegt sind und insofern der herbivorischen »Art des Sehens« entsprechen. Anstelle der Vielfalt der Perspektiven ist es bei ihnen stets nur ein Prinzip – die Harmonie der Zahlen und Zahlenverhältnisse, die Kraft der Wissenschaft, die Weisheit der Erwählten, der Wille des Princeps, die Herrschaft der Experten –, das über die Geschicke der Menschen bestimmt.
Auch eine künftige globale Gesellschaft, die den Vegetarismus / Veganismus als verpflichtenden Kollektivstandard durchsetzt, wäre demnach nicht mehr perspektivisch und plural, sondern gleichgerichtet harmonisch strukturiert: eine einheitlich verfaßte, universale Ordnung, die nicht mehr aus mannigfaltigen politischen Einzelgebilden besteht und eine Vielfalt der Anschauungen nicht länger kennt. Es wäre eine universale, Konformität erheischende Welt, die nur noch einem Herrn gehorcht, in der ein Austausch der Anschauungen und Gedanken unnötig geworden ist, weil nur noch eine legitime Meinung existiert und man reinen Gewissens eine gemeinsame, allseits für moralisch richtig erachtete Linie verfolgt.
– – –
(1) – »Grüne: Bremer sollen sich vegan ernähren«, auf jungefreiheit.de, 31. August 2022.
(2) – Colin Spencer: Vegetarianism. A History, London 2016, S. 48.
(3) – Ovid: Metamorphosen, Liber XV, 75 – 85.
(4) – Stefan Bollmann: Monte Verità. 1900 – der Traum vom alternativen Leben beginnt, München 2019, S. 133.
(5) – Oswald Spengler: Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, Berlin 2016, S. 11 f.
(6) – Ebd., S. 31.
(7) – Ebd., S. 12.
(8) – Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1967, S. 56 f.