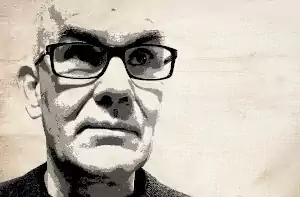Interessant zunächst das Empfinden des Schattens, der von Krieg und Nachkrieg her auf die Gegenwart des Heranwachsenden fällt. Noch waren in den Sechzigern und Siebzigern die Kriegsversehrten in ihren Rollstühlen unterwegs: »Der Krieg war mein Nichtsein, und sie, die Invaliden, waren dessen böse Geister.«
Schmidt möchte diese Vergangenheit, dieses »Vor-45«, als eine Art deutsches Altertum identifizieren: zwar kaum vergangen, aber schon »von der Gegenwart durch eine unüberwindliche Schranke abgetrennt«. Gewissermaßen ein mythisch-düsteres Zeitalter, bereits nach wenigen Jahren den Nachgeborenen unvorstellbar fremd. Nachkriegsdeutschland ignorierte, verdrängte, tabuisierte. Trotz politischer Turbulenzen in der Erwachsenenwelt erlebten die Boomer ihre Kindheit in Geborgenheit: »Geburtstage werden andauernd gefeiert, wie denn der Familienverband auch beständig anwächst. Am Nachmittag gibt es Erdbeertorte, am Abend lauert wieder der eklige Heringssalat. Es trifft sich immer wieder derselbe Kreis aus Omas und Opas, Schwestern, Brüdern, Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins.«
Die Väter arbeiteten Vollzeit und rauchten »Ernte 23«. Aus all den orangenen Schachteln baute der junge Schmidt Burgen. Diese Biedermeierlichkeit wurde von einem »Schutzstaat« beschirmt: »Nichts Heroisches möge in die neue Zeit mehr hineinragen. […] Die Bundesrepublik war modern, freiheitlich und liberal – und trotzdem entwickelte sie sich eigentümlich innengewandt, fast wie ein skandinavisches Land.« Dazu passend der Kindersegen der demographisch starken Jahrgänge: »Immer zusammen, immer im Rudel, fast alle mit Geschwistern, inmitten strampelnder, sich schlängelnder Kinderleiber, in allen Verwahranstalten als Herde behandelt.«
Während die Vorgängergeneration, die eigentlichen Achtundsechziger, renitent motzten und als »Halbstarke« ihre Mopeds aufheulen ließen, wurden die Boomer West zu den Hätschelkindern und Beobachtungsobjekten der so neuen wie fatalen Pädagogik der Siebziger. Zwar gab es noch jene Lehrer, die »Schnurren aus dem Rußlandfeldzug erzählen oder sich in ihr Stuka-Cockpit zurückträumen« wollten, aber prägend wurden »die neuen Ingenieure der Menschenformung, aber sie sind jetzt gute Jugendführer die mit dem richtigen Menschenbild im Gepäck.«
Daß der Autor dies derartig undifferenziert gutheißt, ist offenbar nicht nur sein Problem, sondern überhaupt das der geschützt nachwachsenden Intellektuellen. »Wir lernen das Argumentieren und Debattieren.« Wie artig doch! Und das bleibt jahrzehntelang die Hauptsache: »Wie demokratisiert man eine Gesellschaft, die darauf besteht, bereits demokratisch zu sein, und die um des Wohlstands willen an kapitalistischen Besitzverhältnissen festhält?« Unten also Kapitalismus, mindestens noch soziale Marktwirtschaft –auf daß weiter alle hedonistischen Bedürfnisse befriedigt werden –, oben aber eine Art sozialistischer Überbauhimmel der Teilhabeseligkeit.
Während sich der erste Teil des Buches literarisch wertvoll liest, läßt sich Schmidt im zweiten dazu hinreißen, nur mehr aus seiner Ich-Perspektive zu schreiben und sich zum Sprecher der Boomer-Kohorte aufzuwerfen, indem er sein politisches Credo im Namen aller verkündet.
Man liest selbstgefällige Geschichten von intellektuellen Stehpartys: Schmidt im pointierten Gespräch mit den Großen der Zeit, mit Siegfried Unseld, Jürgen Habermas, später mit Gerhard Schröder. Dazu allerlei Anekdötchen im eitlen Memoirenton, die eine unangenehme Arroganz des Rechthaberischen vermitteln.
Und das signifikante »Mea culpa!«: Wir Gegenwärtigen als Speerspitze unheilvoller Entwicklung, die Lebensziele im großen wie kleinen schon längerfristig völlig falsch und sogar Ursache für ein generelles Dementi unserer Kultur. Der weiße Mann, so Schmidt, sei verantwortlich für den Sündenfall der Frühmoderne.
Der Rest ist politische Programmatik: Schmidt beschwärmt die Dekonstruktion als seine Lebensinspiration im Sinne einer »blühenden, munter fortmäandernden Analytik der Kultur«, mehr noch »als Freiheitslehre«, die die Gesellschaft endlich von der Illusion befreite, »sie sei von Natur aus so, wie sie war, und besitze eine fest gefügte Identität.« Überhaupt alles Identitäre und sowieso das Nationale, allgemein jede Identifikationsmöglichkeit gilt ihm als gefährlich.
Statt dessen: »Die Welt als Summe von Bedeutungsmöglichkeiten anzusehen, sie zuerst voneinander zu trennen, um sie wieder zusammenzusetzen, nahm sich im Überschwang fast wie ein Programm für eine neue Zivilgesellschaft aus.« Das gipfelt in dem Resümee: »Wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte.«
Das Geschenk der deutschen Einheit bringt Schmidt folgerichtig ins Schlingern; letztlich stört sie, denn die Frage nach der Nation »wurde von uns zwar aufgeworfen, debattiert, am Ende aber liegengelassen. […] Der Aufruf zur Neugründung der Bundesrepublik im aktiven Vollzug eines linksliberalen Konsenses war für uns in Wirklichkeit so wenig anziehend wie das erneuerte Nationalgefühl.«
Nicht nur alles vorm Grundgesetz Geschehene, sondern insgesamt die deutsche Nation gehört nach Auffassung des Autors einem Altertum an, das besser vergessen werden sollte.
– – –
Thomas E. Schmidt: Große Erwartungen. Die Boomer, die Bundesrepublik und ich, Hamburg: Rowohlt 2022. 256 S., 23 €
Dieses Buch können Sie auf antaios.de bestellen.