erinnert in seinen Ausführungen u.a. an das überaus erfolgreiche Zusammenspiel von Reichsbank und deutschen Banken zur Industriefinanzierung.
Die daraus entstandene „Verschmelzung von Industrie, Bankwesen und Regierung“ war, so Hudson, „zweifellos die Haupttriebkraft für den Erfolg der deutschen Unternehmen“. Dieser „deutsche Sonderweg“, den unter anderem Thomas Hoof in der Sezession (27 / Dezember 2008) zum Thema gemacht hat, kann auch als „langandauernder Kulturkampf“ gedeutet werden, der im Zweiten Weltkrieg „heiß“ geworden sei, wie der von Hoof zitierte deutsche Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser hervorhebt.
Vor diesem Hintergrund ist er „als Bruderkrieg zwischen unterschiedlichen Zweigen der kapitalistischen Großfamilie“ zu deuten, bei dem die „Beseitigung korporativistischer Besonderheiten des deutschen Wirtschaftssystems ganz oben auf der Liste amerikanischer Kriegsziele stand“.
Auch der 8. Mai 1945 konnte, so Hoof, diese Traditionslinien nicht einfach zertrennen, die in der Folge als „Rheinischer Kapitalismus“ oder als „Deutschland AG“ einen neuen Rahmen fanden. Endgültig gekappt wurden sie erst von der rot-grünen Regierung Schröder/Fischer, die sich zum Vollstreckungsgehilfen der Interessen der „internationalen Kapitalmärkte“ mit ihren Epizentren City of London und Wall Street machte. Mit dem „deutschen Sonderweg“ ist es seitdem vorbei.
Es ist aufschlußreich, an dieser Stelle noch einmal nachzuvollziehen, mit welchen Mitteln vor allem die Regierung Schröder das Erfolgsmodell „Deutschland AG“ auf den Schrottplatz der Geschichte verbannt hat, um Deutschland „fit“ für die „Herausforderungen der Globalisierung“ zu machen. Der Erfolg scheint den Abwrackern der „Deutschland AG“ vorerst recht zu geben: Deutschland darf sich als „Exportweltmeister“, der sich indes zunehmend den Groll seiner Handelspartner zuzieht, bisher – schaut man nur auf das nackte Zahlenwerk – auf der Gewinnerseite der „Globalisierung“ einordnen; es ist zu einer Art Musterknabe des Finanzmarktkapitalismus geworden.
Diese Pole position hat allerdings ihren Preis: Vorbei sind seit der Regierung Schröder/Fischer nämlich die Zeiten, in denen die börsennotierten Unternehmen in Deutschland im Besitz deutscher Anleger waren. Mittlerweile sind fast 60 Prozent der Aktien der im Leitindex Dax notierten deutschen Unternehmen in ausländischem Besitz.
Nicht anders als dramatisch muß die Verschiebung der Anteilseigner bei renommierten deutschen Unternehmen wie Siemens, Daimler oder auch Bayer genannt werden; hier sind die Anteile deutscher Aktionäre auf ein Drittel oder sogar weniger geschrumpft. Der Journalist Constantin Schreiber brachte diese Entwicklung bereits vor Jahren im Titel seines Buches auf den Punkt: Ausverkauf Deutschland (2010).
Der heute zum Finanzmarktkapitalismus mutierte Kapitalismus hat seine Wurzeln im angelsächsischen Raum; er ist, Johannes Hoof hat hier die Linien ausgezogen, Ausdruck des angelsächsischen Wirtschaftsverständnisses, das sich grundlegend von dem europäischen, vor allem aber von (mittlerweile für überholt erklärten) deutschen Ordnungsvorstellungen unterscheidet. Allerdings unterliegt auch das angelsächsische Wirtschaftsverständnis Metamorphosen, was insbesondere für Ära Margaret Thatcher und Ronald Reagan gilt.
Deren Namen stehen „für einen ideologischen Gezeitenwechsel“ „in den angelsächsischen Ländern“; so drückte es FAZ-Redakteur Philip Plickert in seiner grundlegenden Arbeit Wandlungen des Neoliberalismus (Stuttgart 2008) aus. Thatcher führte eines der bisher radikalsten Privatisierungs- und Deregulierungsprogramme durch und veränderte damit nicht nur Großbritannien, sondern im Verbund mit Ronald Reagan auch Westeuropa.
Der Weg dorthin war keineswegs zwingend oder eine Folge immer „offenerer Märkte“, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Für diese „Revolution“ stehen Schlagworte wie Entstaatlichung, Deregulierung, Privatisierung, Flexibilisierung, Entbürokratisierung, Subventionsabbau und Reform des Sozial- und Wohlfahrtsstaates. (Linke und rechte) Kritiker dieser Revolution bringen diese Veränderungen gern mit dem Kampfbegriff „Neoliberalismus“ auf den Punkt.
Seitdem gilt der Markt als „Naturgesetz“, der, wie es Jens Jessen in einem Beitrag für die ZEIT ausdrückte, zur „Schicksalsmacht“ erhoben worden sei. Von diesem „Markt“ sei aber nichts als „Darwinismus“ geblieben, der die „Aussonderung schwacher Schuldner, schwacher Staaten, schwacher Arbeitnehmer feiert“. Dieser ausschließlich renditegetriebene Markt geht einher mit Begriffen wie Fusionen und Aufkäufe bzw. Zerschlagung von Unternehmen, Private Equity, Hedgefonds oder Public Private Partnership, den Leitbegriffen der Ära des Finanzmarktkapitalismus.
Bei dieser „Aussonderung“ kann es auch schon einmal zu „Kollateralschäden“ kommen, die eigentlich Gründe genug bieten sollten, den Ausverkauf deutscher Unternehmen und das Dogma „offener Märkte“ einmal grundsätzlich zu überdenken. Ein schlagendes Beispiel hierfür ist der Fall des Schwarzwälder Elektronik-Unternehmens Saba. 1980 wurden Saba zunächst von dem französischen Thomson-Konzern übernommen, womit der Abstieg begann. Dann stieg die chinesische TCL-Gruppe ein; nachdem die Chinesen das Know-how abgezogen und das Unternehmen finanziell ausgeweidet hatten, trieben sie es in die Insolvenz. In seiner besten Zeit beschäftigte Saba mehr als 6.000 Mitarbeiter; am Ende waren es gerade einmal 125.
Dominierendes Prinzip dieser Welt ist das in den USA entwickelte betriebswirtschaftliche Konzept des Shareholder value (dt. Aktionärswert). Der Shareholder-value-Ansatz geht auf den US-amerikanischen Management-Professor Alfred Rappaport zurück, der in den 1980er Jahren mit der Veröffentlichung des Buches Creating Shareholder Value die Grundlagen lieferte. Der Durchbruch des Shareholder-value-Konzeptes – so etwas wie die Antithese der bis dahin praktizierten deutschen Unternehmenskultur – rückte die kapitalmarkt- bzw. aktionärsgesteuerte Unternehmensführung mit maximaler Gewinnorientierung, kurzfristiger Rechnungslegung und möglichst rascher Gewinnausschüttung in den Mittelpunkt.
Nicht die Vermögenswerte in der Bilanz sind seitdem die Parameter, die den Wert eines Unternehmens bestimmen, sondern die Summe der künftigen Überschüsse an Barmitteln, genannt „Cashflow“. Das alles überlagernde Ziel ist deshalb die Steigerung der Dividenden und des Aktienkurses. Nicht mehr die langfristige Entwicklung eines Unternehmens steht im Fokus, sondern der kurzfristige Erfolg, der durch die Aktienoptionen, die Führungskräfte haben, weiter forciert wird.
Je höher der Aktienkurs des eigenen Unternehmens, desto höher der eigene Profit. Die Kehrseite: Wenn sich Renditeerwartungen nicht erfüllen, kann sich der Kapitalzufluß schlagartig verringern, wenn nicht gar verebben, und der Börsenkurs sinkt. Hier liegt auch der Grund, warum selbst erfolgreiche Unternehmen, wenn sich Renditeerwartungen nicht realisieren lassen, Personal „abbauen“ müssen.
Je weiter die Anteile deutscher Anleger an börsennotierten deutschen Unternehmen sinken, desto größer wird das Gewicht von US-Global-players wie zum Beispiel BlackRock – der über fünf Billionen Dollar an Vermögen verwalten soll – oder von Institutional Shareholder Services (ISS), einem sogenannten Aktionärsberater. Es gibt kein deutsches Aktienunternehmen, an dem, so die FAZ, BlackRock nicht „im nennenswerten Umfang“ beteiligt sei.
Regierungen sollen immer dann, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, die Nummer von BlackRock-Chef Laurence („Larry“) D. Fink wählen. BlackRock, das gern im Hintergrund bleibt, gehört im übrigen zu den Kunden von ISS, von dessen Deutschland-Chef die Wirtschaftswoche berichtete, daß er „Vorstandskarrieren bremsen kann, Aufsichtsräte aus dem Amt kegeln“ und „Kapitalerhöhungen blockieren“ könne.
Da viele Anleger nicht die Zeit haben, auf die Hauptversammlungen der Unternehmen zu gehen, in die sie investiert haben, werden „Aktionärsberater“ beauftragt. Diese instruieren die (Groß-)Investoren und geben ihnen „Empfehlungen“ für wichtige Abstimmungen. ISS hat eine marktbeherrschende Position; entsprechend hoch muß der Einfluß dieser Berater veranschlagt werden. Ausländer mischen sich damit immer mehr in den Kurs „deutscher“ Konzerne ein. Dazu bedarf es noch nicht einmal eines Auftretens auf Hauptversammlungen, wie der Deutschland-Chef von BlackRock gegenüber der FAZ deutlich machte: „Wir nehmen Verantwortung für unsere Kunden wahr, indem wir direkt mit dem Management sprechen.“
Parallel zum Aufstieg des Marktes zur „Schicksalsmacht“ verläuft der Niedergang der sozialen Marktwirtschaft, der durch den Prozeß der „Europäisierung“ und die Massenmigration noch weiter an Fahrt gewinnt. Durch den Verlust der Währungshoheit ist die autonome Geldpolitik als wichtiges Instrument der Wirtschaftssteuerung mit weitreichenden Folgen verlorengegangen. Mehr und mehr Politikfelder und Vorschriftenbereiche werden aus der nationalstaatlichen Hoheit ausgegliedert, sei es das Kreditwesen, der Verkehr, der Energiesektor, das Fernmeldewesen oder die Wertpapier- und Kapitalmärkte.
Damit wird der staatlichen Souveränität, die die Voraussetzung für das bisherige nationalstaatliche Modell der sozialen Marktwirtschaft bildete, der realwirtschaftliche und der politische Boden entzogen. Das gilt insbesondere für die deutsche Alternative zum angelsächsischen Kapitalismus, der der französische Wirtschaftswissenschaftler Michel Albert in seinem 1991 erschienenen Buch Kapitalismus contra Kapitalismus den Namen „Rheinischer Kapitalismus“ gab.
Die Liquidierung der „Deutschland AG“ ist politisch gewollt gewesen und wurde auch und gerade durch deutsche Politiker nach Kräften befördert. Beschleunigend wirkten zum Beispiel die Treuhandanstalt und die rot-grüne Regierung der Ära Gerhard Schröder. Für den Einbruch von US-Investmentbanken wie Goldman Sachs oder Wirtschaftsprüfern wie PricewaterhouseCoopers in die „Deutschland AG“ sorgte aber zunächst die Treuhandanstalt.
„Vor allem US-Banken wie Goldman Sachs“, so der Journalist Werner Rügemer in seinem Buch „Privatisierung in Deutschland“ (Münster 2008), „arrangierten die großen Privatisierungen, z. B. des Leuna-Kombinats. Dabei trieben sie […] die Provisionen in solche Höhen, die bisher den Top-Banken in Deutschland unbekannt waren.“ 1998 erfolgte die Öffnung des deutschen Handelsbilanzrechts; angeblich, um die finanzielle Lage der Unternehmen „transparenter“ zu machen. Von diesem Zeitpunkt an war eine moderate Dividendenpolitik nicht mehr möglich. Die Internationalisierung der Bilanzierungsregeln wies den Weg in den Aktionärskapitalismus, in dem Investmentgesellschaften den Ton angeben bzw. als neue Eigentümer auftreten.
Im gleichen Maße wurde die „Deutschland AG“, die nun als nicht mehr „zeitgemäß“ „kommuniziert“ wurde, als „Welt der Strippenzieher“ denunziert, die ihre Spielchen angeblich auf „Kosten der Effizienz“ spielten – so pars pro toto Daniel Schäfer in seiner „Heuschrecken“-Apologie Die Wahrheit über die Heuschrecken (Frankfurt/Main 2007). Die angelsächsischen Fonds hingegen seien „Agenten des Wandels“, so Schäfer geradezu euphorisch, „die den unaufhaltsamen Umbau vom rheinischen Kapitalismus zum angelsächsisch geprägten Modell“ beschleunigten. Es ist bezeichnend, daß der Handelsblatt-Redakteur Schäfer für dieses Buch den „Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2007“ erhielt.
Die rot-grünen „Agenten des Wandels“ in der Ära Schröder/Fischer taten das Ihrige, um den Forderungen des Finanzmarktkapitalismus zu entsprechen. Bei Lichte betrachtet ging es ihnen aber um nichts anderes als um die Entnationalisierung der deutschen Wirtschaft: Rot-Grün sei „ein Bündnis gegen den Konservativismus“ gewesen, konstatierte der Ökonom Gustav Horn, „politisch gegen Helmut Kohl, ökonomisch gegen die alte Deutschland AG“ (Spiegel Online, 4. März 2009).
Dabei machten sie Nägel mit Köpfen, so bei den rot-grünen Steuerreformen, die mit dem Investmentmodernisierungsgesetz im Jahre 2003 „abgerundet“ wurden, das die Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen steuerfrei stellte. Deutsche Banken reduzierten daraufhin ihre Anteile an deutschen Unternehmen drastisch und investierten in neuen Geschäftsfeldern. Gleichzeitig erwarben sie mit zweifelhaftem Erfolg, denkt man z.B. an den Niedergang der Deutschen Bank, weltweit Beteiligungen und bauten Niederlassungen auf.
Die rot-grüne Politik hatte damit einen entscheidenden Anstoß in Richtung Finanzmarktkapitalismus ausgelöst, flankiert von einer Union, der manche Regulierungsmaßnahme immer noch nicht weit genug ging. Die Konsequenzen sollten nicht lange auf sich warten lassen. Schnell drängten ausländische Investmentfonds auf den deutschen Markt, mit dem Effekt, daß der Anteil ausländischer Aktionäre immer weiter steigt. Das spätere Herumgeraunze des damaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering über die „Heuschrecken“ (2005) steht damit in einem mehr als entlarvenden Licht, war es doch gerade auch seine Partei, die ebendiesen „Heuschrecken“ den Weg geebnet hat.
Wem Rot-Grün mit all dem gefällig war, hat wiederum Werner Rügemer durchblicken lassen, der in der linken Wochenzeitung Freitag vom 11. Februar 2005 Schröder wie folgt zitierte: „Es gibt ein großes Interesse in den Vereinigten Staaten an der Agenda 2010.“ So Schröder im November 2003 auf einer US-Reise, auf der er unter anderem Laudatio auf Sanford Weill hielt, dem damaligen Chef und Gründer der Citigroup. Eine Freundschaft des „Genossen der Bosse“, die sich für die US-Finanzwirtschaft in klingende Münze verwandelt hat, wie Rügemer recherchierte: „Nicht nur die Agenda 2010, sondern auch die Steuerreform 2000 (steuerfreie Erlöse aus Unternehmensverkäufen) gehen nicht zuletzt auf die stille, aber erfolgreiche Lobbyarbeit der US-Finanzbranche zurück.“
Wohl auch deshalb beeilte sich Schröder, die Stelle eines Bundesbeauftragten für Auslandsinvestitionen zu schaffen, die er mit Hilmar Kopper, damals unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, besetzte. Nach Koppers Ausscheiden mutierte diese Stelle zur Bundesagentur „Invest in Germany GmbH“ (mittlerweile in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland aufgegangen), die mit ihren finanziellen Mitteln nach Rügemer damals drei Außenstellen betrieb, nämlich in New York, Chicago und Los Angeles…
Die Regierung Schröder hat, darauf sei zur Abrundung des Bildes hingewiesen, auch einer neuen Mentalität unter deutschen Politikern, die stellvertretend für den Wandel der europäischen (Funktions-)Eliten generell steht, zum Durchbruch verholfen: Seither nämlich gehört es zum „guten Ton“, daß aus dem Amt geschiedene Politiker – so wie in den USA, dem großen Taktgeber – ihre im Amt geknüpften Beziehungen via „Drehtüreneffekt“ schnellstens vergolden, sei es in Form von Beraterverträgen, sei es in Form von Geschäftsführerposten oder Aufsichtsratsmandaten.
Über den, um es vorsichtig zu sagen, Grad von „Gefälligkeiten“, der sich in den entsprechenden „Netzwerken“, die „die Welt regieren“ entwickelt hat, kann man nur spekulieren. Als „Hubs“ oder gar „Super-Hubs“ (Sandra Navidi) betreiben sie, besser als Rügemer kann man es nicht formulieren, (in eigener Sache) „stille, aber erfolgreiche Lobbyarbeit“, die sich selbstverständlich bei der „Optimierung“ des eigenen Bankkontos bemerkbar macht.
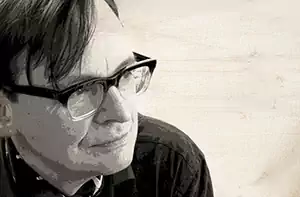
Caroline Sommerfeld
Damit wird der staatlichen Souveränität, die die Voraussetzung für das bisherige nationalstaatliche Modell der sozialen Marktwirtschaft bildete, der realwirtschaftliche und der politische Boden entzogen.
Dann ist es ja kein Wunder, daß aus US-amerikanischer Perspektive alle in Frankreich zur Wahl antretenden Kandidaten als "sozialistisch" zu sehen sind. Le Pen steht für einen "nationalistic socialism", nein, nicht falsch zu verstehen, das ist ökonomisch gemeint, und zwar ganz im Sinne von Wiesbergs Ansatz.
Vielen Dank für Ihre Wirtschaftserklärtexte - als Philosophin ist mir Nationalökonomie ein Buch mit sieben Siegeln. Jedes, das aufgebrochen wird, gibt offensichtlich den Blick frei auf ein weiteres Stückerl Apokalypse ...