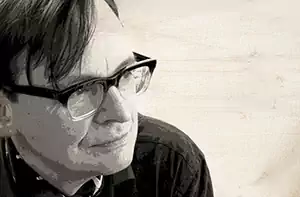Aus dem umfangreichen Nachlaß des 1998 verstorbenen Soziologen und Gesellschaftstheoretikers Niklas Luhmann hat der Suhrkamp Verlag drei Aufsätze aus den 1960er Jahren, darunter einen bisher unveröffentlichten, zu einem handlichen Brevier kompiliert, das durch seine Signalfarbe Orange unübersehbar ins Auge sticht. Der neue Chef heißt das Büchlein und trägt damit den Titel eines der drei Aufsätze. Der FAZ-Mitherausgeber und Luhmann-Schüler Jürgen Kaube (Nachfolger des im Juni 2014 verstorbenen Frank Schirrmacher und ebenso wie dieser für das Feuilleton zuständig) hat ein Nachwort beigesteuert, in dem er die diskursiven Rahmenbedingungen dieser drei Aufsätze aufzeigt, die im Umfeld von Luhmanns 1964 publiziertem Buch Funktionen und Folgen formaler Organisation entstanden sind.
Welchen Wert hat ein Aufsatz des Ministerialbeamten Luhmann – in dieser Funktion war er von 1954–1962 tätig – über Probleme, die beim Wechsel von Vorgesetzten entstehen können, aus heutiger Perspektive? Luhmann nimmt die Erschütterungen, die ein Wechsel an der Führungsspitze in jeder Organisation auslöst, akribisch unter die Lupe und spiegelt das komplizierte Beziehungsgeflecht zwischen Vorgesetzten und Untergebenen wider. Da sind einmal Kommunikationsschwierigkeiten und Rollenfindungsprobleme, aber auch unterschiedliche Wertvorstellungen zu nennen. Der neue Chef bekommt es womöglich mit innerbetrieblichen Cliquen (heute würde man wohl »Netzwerke« sagen) zu tun, die sich einen mehr oder weniger großen Einfluß verschafft haben. Damit steht die Machtfrage im Raum, die nicht a priori zugunsten des neuen Chefs entschieden ist. Verstehen es nämlich die Untergebenen, ihren Chef subtil zu lenken, stellt sich die Machtfrage differenzierter dar. Luhmann hat diesem Phänomen einen eigenen Aufsatz gewidmet: »Unterwachung oder die Kunst, Vorgesetzte zu lenken«. Bei der Diskussion darüber, welche Mittel dabei anzuwenden wären, demonstriert Luhmann, warum ihn der Spiegel als »Ikone der Kühle und der intellektuellen Mokanz« charakterisiert hat, empfehlt er doch folgenden Kunstgriff: »Hilfreich ist dabei die Vorstellung, der Vorgesetzte habe keine Kleider an.«
Ein neuer Chef mag zwar die formalen Zuständigkeiten beherrschen, wird sich aber mit der »informalen Ordnung« von »Cliquen« – wie sie unter anderem in dem Aufsatz »Spontane Ordnungsbildung« diskutiert werden – erst noch vertraut machen müssen. »Jedenfalls gehören Unbefangenheit und Pietätlosigkeit gegenüber lokalen Gewohnheiten« zur Anfangsrolle eines neuen Chefs. Eine solche Einstellung werde erwartet und dessen Umgebung »skeptisch und zurückhaltend stimmen. Sie hält sich in Verteidigungsbereitschaft«. Es liegt im Ermessen des neuen Chefs, mit welchen Mitteln, die Luhmann ausführlich darstellt, er dieser Umgebung seinen Stempel aufdrückt und den »Hostile Native«-Komplex – wie er mit Blick auf die neuen Chefs nach dem Einzug der Eisenhower-Verwaltung in den USA genannt wurde – durchbricht.
Gelegentlich eingestreute Formulierungen wie »Jede soziale Ordnung kann funktional analysiert werden« lesen sich heute als ein Art Indikator jener Einflüsse auf Luhmann, die der US-Soziologe Talcott Parsons und dessen strukturfunktionale Systemtheorie im Rahmen eines Fortbildungs-Stipendiums für die Harvard-Universität in den Jahren 1960/61 bewirkt haben mögen. Luhmann erweiterte in der Folge die Theorie Parsons, verwendete aber nicht mehr den Handlungsbegriff, sondern den allgemeineren Begriff der Operation. Wenn Operationen aneinander anschließen, entstehen Systeme. Kommunikation ist nach Luhmann die Operation, in der soziale Systeme entstehen. Schließt eine Kommunikation an eine andere an, entsteht ein sich selbst beobachtendes soziales System. Kommunikation wird durch Sprache und durch »symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien« wie Geld, Wahrheit, Macht oder Liebe – einem zentralen Topos in der Systemtheorie Luhmanns – wahrscheinlichgemacht.
Im Hinblick auf Luhmanns Kommunikationsbegriff ist die Besonderheit zu beachten, daß er Kommunikation nicht als Handeln deutet, das einzelne Menschen in den Blick nimmt. Statt von Menschen geht Luhmann von der Kommunikation konstruierter Einheiten (»Identifikationspunkten«) aus; er argumentiert, so erläutert beispielsweise Norbert Bolz den Luhmannschen Ansatz, bewußt am Menschen vorbei; weder sei dieser ein System noch das Element eines Systems. Das gipfelt in dem provokanten Satz: »Die Gesellschaft besteht nicht aus Menschen, sie besteht aus Kommunikationen zwischen Menschen.«
Luhmann unterscheidet drei Typen sozialer Systeme, nämlich Interaktions‑, Organisations- und Gesellschaftssysteme. Interaktionssysteme bestehen aus einmaligen Begegnungen in Gesprächen, die an der Supermarktkasse, auf Partys oder bei einem Geschäftstreffen stattfinden können. Organisationen (z.B. Unternehmen) fußen auf einer Mitgliedschaft und klar verteilten Kompetenzen. Die Gesellschaft umfaßt nach Luhmann alle Kommunikationen und ist weder personell noch territorial abgrenzbar. Gesellschaft ist das umfassende System, das sich in Funktionssystemen ausdifferenziert. Auf diese Weise entstehen unter anderem das Recht, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Politik, die Religion als funktional ausdifferenzierte Systeme. Die soziale Welt besteht also, versucht man Luhmann auf den Punkt zu bringen, aus Systemen und kann deshalb mithilfe der Systemtheorie beschrieben werden. Wo in diesen Systemen wären dann Netzwerke zu verorten?
Bezeichnenderweise wird der Begriff Netzwerk im Luhmannschen Werk nur gelegentlich benutzt; so zum Beispiel in der grundlegenden Konzeption des Autopoiesis-Begriffs, später dann auch mit Blick auf Phänomene wie Mafa, Favelas oder Organisationsnetzwerke. Autopoiesis defnierte Luhmann einmal dahingehend, »daß ein System seine eigenen Operationen nur durch ein Netzwerk der eigenen Operationen erzeugen kann. Und das Netzwerk der eigenen Operationen ist wiederum erzeugt durch diese Operationen«. Die »basale Ressource des Netzwerks scheint zu sein«, so Luhmann Mitte der 1990er Jahre, »daß man jemanden kennt, der jemanden kennt; und daß das Bitten um Gefälligkeiten derart verbreitet ist, daß man, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat zu helfen, es nicht ablehnen kann, ohne binnen kurzem aus dem Netz der wechselseitigen Diskurse ausgeschlossen zu werden«. Das Netz erzeuge einen eigenen »Exklusionsmechanismus«, der bewirken könne, daß man zur »Unperson« wird, die niemand kennt und die eben deshalb »trotz aller formalen Berechtigungen auch keinen Zugang zu den Funktionssystemen fndet«.
Die Grenze zwischen Exklusion und Inklusion werde durch netzwerkartige Strukturen von wechselseitigen Gunsterweisen konstituiert. Wer in solche Netzwerke eingebunden sei, könne auch in den Funktionssystemen auf Inklusion rechnen. Netzwerke entstehen nach Luhmann aus der Gewohnheit, in »Netzwerken der Hilfe, der Förderung und der erwartbaren Dankbarkeit zu denken«. Netzwerke sind aus der Sicht von Luhmann damit »reale soziale Strukturen«, die durch das Denken in diesen Strukturen konstituiert werden.
Luhmann hat sich, darauf hat unter anderem der Soziologe Jan Fuhse hingewiesen, nie grundsätzlich über das Verhältnis von System- und Netzwerkbegriff geäußert. Ob er die von ihm beschriebenen Netzwerkphänomene auch als soziale Systeme aufgefaßt hat, darüber kann nur spekuliert werden. Möglicherweise hängt dieser theoretische »Schwebezustand« der Luhmannschen Beobachtungen im Hinblick auf das Phänomen Netzwerke mit dem oben bereits angesprochenen methodischen Antihumanismus seiner Systemtheorie zusammen. Der Mensch ist im Denken Luhmanns, so Norbert Bolz mit unüberlesbar ironischem Unterton, kein System, und immer dann »wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, steht er der Wissenschaft im Weg«. Luhmann brachte diese methodische Grundentscheidung knapp und klar mit der Einlassung: »Der Mensch interessiert mich nicht.« auf den Punkt. Es überrascht vor diesem Hintergrund nicht, daß er das Thema Netzwerke, in dem bestimmte Charakteristika der Natur des Menschen zum Tragen kommen, eher kursorisch streifte. Daß Luhmann zuletzt den Faktor Mensch in seinen systemtheoretischen Reflexionen doch wieder in den Blick nahm, war unter anderem durch seine Beobachtungen in den brasilianischen Favelas motiviert.
In diesem Zusammenhang wäre es aufschlußreich, wie Luhmann heute ein Phänomen wie das der transnationalen Netzwerke der Finanzeliten und deren Inklusions- und Exklusionsmechanismen bewertet hätte, das jüngst von der Finanzexpertin Sandra Navidi in ihrem Buch Super-Hubs umfassend thematisiert wurde. Navidi macht gleich in der Einleitung klar, was das »exklusivste und wertvollste Gut« der Finanzchefs und »hochrangigen Entscheidungsträger« ist, nämlich »ein allumspannendes Netzwerk höchstpersönlicher Beziehungen«. »Vernetzt-Sein« sei angesichts »fortschreitender Globalisierung« unerläßlich, denn es werde als »Teil des Humankapitals bei Führungskräften vorausgesetzt« und stelle gegenüber gleich qualifizierten Konkurrenten »einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil« dar. Das »Netzwerk-Kapital«, zu denen Navidi »Status, Reputation und das Transaktionspotenzial des sozialen Kapitals« zählt, korrelieren direkt mit »finanziellem Gewinn und Macht«.
Als »Super-Hubs« bezeichnet Navidi die am besten vernetzten Knotenpunkte im Zentrum der transnationalen Finanznetzwerke. Hierbei handele es sich um ein paar hundert Führungskräfte weltweit, die »den Dialog dominieren«. Sie mögen nicht so bekannt oder prominent wie Politiker sein, »aber einer globalen ›Überregierung‹ gleich verfügen sie über eine größere Machtfülle als gewählte Volksvertreter«. Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek kommentierte diese Entwicklung mit der bezeichnenden Schlagzeile »Der Aufstieg der Überklasse«. Im »Nervenzentrum« internationaler Netzwerke sieht Navidi unter anderem George Soros, seit zwei Jahrzehnten zum Beispiel Stammgast beim Weltwirtschaftsforum in Davos, »wo er das Orchester der Netzwerk-Symphonie virtuos dirigiert«. Netzwerke bestehen aus »Noden« (Knoten), die durch »Leitungen« miteinander verbunden seien. Alle »Noden« konkurrierten fortwährend um neue Verbindungen; je mehr Verbindungen eine »Node« habe, desto größer sei ihre Überlebenschance. Alle »Noden« orientierten sich an den »Super-Hubs« (wie Soros) in dem Bedürfnis, anzudocken. Diese seien begehrt, weil ihr »Sozialkapital« Zugang zu allem und jedem eröffneten.
Menschliche Netzwerke entwickelten sich fortwährend, so stellt Navidi mit Blick auf neuere Forschungsergebnisse fest, »im Einklang mit den Gesetzen der Homophilie« (Vorliebe für das Gleichartige), was nichts anderes bedeute, als daß sich Menschen »vorzugsweise mit Menschen zusammentun, die ihnen ähnlich sind«. Gemeint ist damit ein ähnlicher beruflicher, gesellschaftlicher, bildungsmäßiger oder wirtschaftlicher Hintergrund. Hier beginnen die Exklusions- und Inklusionsmechanismen zu wirken, von denen mit Blick auf Luhmann oben die Rede war. Die »Noden« und erst recht die »Super-Hubs« der Finanznetzwerke bringen einen ähnlichen »kulturellen Fit«, sprich: den passenden »sozioökonomischen Hintergrund« mit, der sich in einer »gewissen Weltläufgkeit, Kultiviertheit und Gravität« manifestiert. Hier sind jene »Strukturen der Distinktion« am Wirken, die der französische Soziologe Pierre Bourdieu in einem seiner wichtigsten Werke auf die Formel »Feine Unterschiede« brachte. Diejenigen, die über gutes Benehmen, Wissen und Bildungstitel verfügen, also über ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital, können, ähnlich wie die Besitzer von Eigentum, auf einen größeren Teil des gesellschaftlich hervorgebrachten Kapitals zugreifen. Ebenso haben jene Vorteile, die hohes soziales Kapital (z.B. ein einflußreiches Netzwerk hoher sozialer Verpflichtungen) besitzen.
Navidi macht klar, warum die Fähigkeit, in transnationalen Finanznetzwerken Beziehungen zu knüpfen, in Zeiten der Globalisierung massiv an Bedeutung gewonnen hat. Ab einer bestimmten Karrierestufe werde von Spitzenkräften das »Vorhandensein eines exzellenten Netzwerkes« erwartet. Beziehungskapital schaffe Netzwerkkapital, was die »Beziehungsrendite« erhöht. Aus dem »Vernetztsein« ist im Zuge der Globalisierung eine gesonderte Wettbewerbskategorie geworden, da diese »einen Aufwärtsdruck auf Qualität und einen Abwärtsdruck auf Preise« ausübt, was es für Unternehmen schwieriger mache, ihre Produkte und Dienstleitungen von Konkurrenten abzuheben. Menschliche Beziehungen bekommen in diesem Kontext eine steigende Bedeutung, weil sie das »Zünglein an der Waage« sein können.
Daß auch »Super-Hubs« nicht vor einem kompletten Netzwerkzusammenbruch gefeit sind, zeigt Navidi anhand des tiefen Falles des ehemaligen IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn, dem sexuelle Übergriffe zum Verhängnis wurden. Sein Fall ist ein schlagender Beleg für Luhmanns oben genannte These, daß das Netz »einen eigenen Exklusionsmechanismus« erzeuge, der bewirken kann, »daß man zur Unperson wird«. Navidi faßt dieses Phänomen in ihre eigenen Worte: Strauss-Kahn war »politisch und persönlich so toxisch geworden«, daß sich Großteile seines persönliches Netzwerk und schließlich auch seine Ehefrau »von ihm distanzierten«.
Offen indes bleibt bei Navidi mit Blick auf Strauss-Kahn und andere Beispiele die Frage, inwieweit das beispiellose Machtpotential, mit der die Netzwerke der Finanzeliten die Geschicke der Welt beeinflussen, korrumpiere – verstanden als Mißbrauch einer Machtposition zum Erzielen persönlicher Vorteile. Ihr Vorschlag nämlich, die »Bevölkerung« solle Druck auf ihre Politiker ausüben, damit diese wiederum »Druck auf die Super-Hubs« machen, nimmt sich vor dem Hintergrund der Tatsache, daß etliche Politiker ja mehr oder weniger Teil dieser Netzwerke sind, doch reichlich naiv aus. Womöglich bedarf es im Sinne des österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter doch wieder einer »schöpferischen« oder »kreativen Zerstörung«, die die bedrohliche Machtakkumulation der transnationalen Finanzeliten und ihrer »SuperHubs« neu justiert.
Im Sinne Luhmanns könnte sich die Gesellschaft als umfassendes System dann neu ausdifferenzieren. Eine »schöpferische Zerstörung« würde auch das unterstreichen, was Luhmann lakonisch einmal in folgende Worte gefaßt hat: »Wir leben, wie man seit dem Erdbeben von Lissabon weiß, nicht in der besten der möglichen Welten, sondern in einer Welt voller besserer Möglichkeiten.«