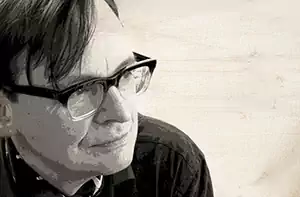Von der einstigen Geschäftsführerin der Atlantik-Brücke, Beate Lindemann, ist die schöne Einlassung »Man kann mehr erreichen, wenn man nicht in der Öffentlichkeit arbeitet« überliefert. Das sagt viel über das Selbstverständnis einer Organisation aus, die als eines der »einflußreichsten Netzwerke dieser Republik« gehandelt wird und gern damit kokettiert, »überparteilich«, da von staatlicher Förderung unabhängig zu sein. Von »Überparteilichkeit« indes kann mit Blick auf diese Organisation nicht die Rede sein; gilt sie doch in Deutschland als einer der wichtigsten Exponenten eines immer enger geknüpften transatlantischen Netzwerks, das sich vor allem eines auf das Panier geschrieben hat: Propaganda für einen möglichst engen Schulterschluß mit den Vereinigten Staaten zu machen.
Vorsitzender ist der einstige CDU-Hoffnungsträger Friedrich Merz, der dem reichhaltigen Portfolio seiner Posten demnächst ein weiteres lukratives Amt hinzufügen darf: Der gelernte Jurist wird Vorsitzender des Aufsichtsrates beim deutschen Ableger des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Diese Personalie paßt ganz ins Kalkül des BlackRock-Gründers Larry Fink, der in den letzten Jahrzehnten ein beispielloses globales Netzwerk aufgebaut hat, in dem er als »Super-Hub« (Super-Knotenpunkt), wie es die Finanzexpertin Sandra Navidi nennt, eine zentrale Rolle spielt.
Die Atlantik-Brücke, deren 500 Mitgliedern Merz vorsteht, ist dabei nicht zu trennen von ihrer Schwesterinstitution American Council on Germany (ACG), die 1952 gleichzeitig von John J. McCloy, von 1949 bis 1952 amerikanischer Hoher Kommissar in Deutschland und damit Nachfolger des Militärgouverneurs General Lucius D. Clay, und dem deutsch-jüdisch-amerikanischen Bankier Eric(h) M. Warburg gegründet wurde. Der ACG ist eine Nichtregierungsorganisation (NGO), die enge Bindungen zur Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) aufweist, dem »unendlich einflußreichen« »Netzwerk der Netzwerke«, wie es der Politologe Hermann Ploppa ausdrückte.
In der Geschichte des CFR gibt es eine bedeutsame Wegmarke, nämlich dessen Ausweitung zur Trilateralen Kommission (TK), die 1973 von David Rockefeller auf einer Bilderberg-Konferenz gegründet wurde. Die Kommission ist eine Gesellschaft mit etwa 400 »Super-Hubs« aus den drei (»Tri«) großen internationalen Wirtschaftsblöcken Europa, Nordamerika und Japan sowie einigen ausgesuchten Vertretern außerhalb dieser Wirtschaftszonen. Auffällig ist die starke deutsche Gruppe der TK, in der sich renommierte Politiker, Journalisten, Banker und Industrielle finden.
Ein wesentlicher Aspekt der Gründung der TK war die Einsicht darin, daß in einer Zeit wachsender Bedeutung multinationaler Konzerne die Macht nationaler Regierungen relativiert werde, da die international agierenden Akteure quer über alle Grenzen hinweg arbeiteten. Diese gegenseitige Abhängigkeit unterschiedlichster Akteure rund um die Welt versucht die »Interdependenztheorie« zu erfassen, die unter anderem von den USPolitologen Robert O. Keohane und Joseph Nye jr., dem aktuellen Vorsitzenden der Trilateralen Kommission in Nordamerika, aufgestellt wurde. Auf Nye geht auch das Konzept der »weichen Macht« (»Soft power«) zurück, das er als Möglichkeit defnierte, Menschen und Nationen durch kulturelle und politische Attraktivität an sich zu binden. Nyes Gedanken sind im übrigen mehr oder weniger deutliche Anleihen an das Konzept zur Erringung kultureller Hegemonie, wie es der italienische Kommunist Antonio Gramsci umrissen hat, auf den sich Nye ganz offen bezieht. Aus dieser postulierten gegenseitigen Abhängigkeit leitet die TK die Legitimation ab, ihren Einfluß auch auf die Bereiche Innenpolitik und nationale Wirtschaftsordnung auszuweiten.
Vor dem Hintergrund der Einsicht von Nye, daß die »amerikanische Macht nicht ewig währt«, gehe das Bestreben des CFR nach den Recherchen von Hermann Ploppa dahin, das »US-amerikanische Betriebssystem des Kapitalismus« in einem Netzwerk von Bündnissen und Institutionen in Nordamerika, Europa und Asien zu betonieren. Das ließ unter anderem der Geschäftsführer des CDU-Wirtschaftsrates Thomas Raabe gegenüber dem Handelsblatt durchblicken; er erklärte, daß angeblich nur noch »wenig Zeit« bleibe, »gemeinsam mit den USA Standards zu prägen, bevor Wachstumsmärkte wie China und Indien den Takt angeben«. Zbigniew Brzezinski, von 1973 bis 1976 Direktor der TK, umriß diese Strategie in seinem nach wie vor instruktiven Buch The Grand Chessboard (1997) wie folgt: »Und weil Amerikas beispiellose Machtfülle dazu verurteilt ist, mit der Zeit dahinzuschwinden, steht an erster Stelle, den Aufstieg anderer Regionalmächte in einer Weise zu bewerkstelligen, die nicht Amerikas Erstrangigkeit bedroht.« »Soft power« spielt hierbei eine wesentliche Rolle; sie wird als genauso wichtig eingestuft wie militärische und wirtschaftliche Stärke. »Soft power« wird also als ein Vehikel zur Erringung kultureller Hegemonie anmoderiert; nach Nye sollten die USA deshalb wie »kluge Eltern« agieren, die ihre »Kinder« mit den »richtigen Überzeugungen und Werten« erzögen. Dann werde ihre Macht über ihre »Kinder« größer und dauere länger, schreibt Nye in seinem Buch The Paradox of American Power (2002), in dem er auch darauf hinweist, daß sich diese Art von Führung kostensparend auswirke. Zu dieser Führung im Geist der »soft power« gehören im übrigen auch die Hunderttausenden von ausländischen Studenten in den USA, die dann als Multiplikatoren des »American Way of Life« in ihren Heimatländern aktiv werden.
Ploppa konstatiert, daß sich vor dem Hintergrund der Aktivitäten der oben skizzierten Netzwerke hinter den Kulissen der Politik eine »transatlantische Wende« vollzogen habe, die unübersehbar »Früchte zu tragen beginnt«. Die im Laufe der letzten zwanzig Jahre erfolgte »institutionelle Ankettung Europas« an die USA sei nur noch »schwer rückgängig zu machen«. Die US-Politik der »Domestizierung« der »Beziehungen der bedeutenden westlichen Staaten zueinander«, wie es der US-Politologe Gilford J. Ikenberry in einer Studie aus dem Jahr 1995 einmal ausgedrückt hat, die in Europa dazu geführt habe, daß die »Kriegsgefahr vom Tisch« sei, würde durch transatlantische Freihandelsabkommen, wie sie jetzt – Stichworte TTIP, TiSA und CETA – verhandelt werden oder verhandelt worden sind (CETA), quasi gekrönt.
Das amerikanische Interesse an diesen Abkommen hat Brzezinski in seinem bereits angesprochenen Buch The Grand Chessboard bereits vor knapp 20 Jahren deutlich gemacht, als er feststellte: Derartige Freihandelsabkommen könnten das »Risiko vermindern, daß es auf wirtschaftlichem Gebiet zu immer stärkeren Rivalitäten zwischen einer geeinteren EU und den Vereinigten Staaten kommt«.
Bereits Mitte der 1990er Jahre stand mit dem Multilateralen Abkommen über Investitionen (MAI) – in dem sich viele Kernpunkte fanden, die heute im Zusammenhang mit TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) verhandelt werden – die Implementierung eines derartigen Freihandelsabkommens im Raum, das letztlich aber aufgrund eines immer stärker werdenden Widerstandes scheiterte. Das MAI, das bereits ein Klagerecht vor internationalen Streitschlichtungsgremien vorsah, hätte eine erhebliche Beschneidung nationalstaatlicher Souveränität bedeutet. Welche Konsequenzen ein derartiges Klagerecht haben kann, hat jüngst der Fall Kolumbien, das mit Kanada und den USA ein Freihandelsabkommen geschlossen hat, gezeigt. Kolumbien hat einem kanadischen und einem US-Unternehmen untersagt, im Regenwald Gold abzubauen. Diese Unternehmen wollen nun von Kolumbien 16,5 Milliarden US-Dollar (14,5 Milliarden Euro) Schadensersatz für entgangene Einnahmen vor einem Schiedsgericht in den USA einklagen. Dieser Fall ist ein Menetekel für die EU und Deutschland, weil er zeigt, welche Mißbrauchsbrauchsmöglichkeiten ein derartiges Klagerecht eröffnet.
Die Grundthese des MAI, aber auch des TTIP, lautet, daß freier Wettbewerb zum höchstmöglichen gesamtgesellschaftlichen Nutzen führen soll. Letztlich läuft dieses (umstrittene) Postulat aber darauf hinaus, daß eine winzige Gruppe von 0,123 Prozent der Eigentümer, die 80 Prozent des Gesamtwerts von 43000 internationalen Konzernen kontrollieren, wie die Systemtheoretiker Stefania Vitali, James B. Glattfelder und Stefano Battiston von der ETH Zürich recherchiert haben, weiter an Macht zunehmen werden. Es seien im Kern 147 Konzerne, die die Wissenschaftler als »ökonomische ›Super-Entität‹« bezeichnen. Diese »Super-Entität« dirigiert ein »kompliziertes Netz von Eigentumsbeziehungen«, besitzt aber zugleich »fast volle Kontrolle über sich selbst«. Von diesen 147 Unternehmungen sind drei Viertel Bankhäuser. Diese Bankhäuser und Finanzinstitutionen befnden sich fast ausschließlich in den USA und Großbritannien. Eigentum aber bedeutet Kontrolle und damit Macht. Dem Finanzgiganten BlackRock zum Beispiel gelingt es, mit zum Teil geringen Prozentanteilen wichtige Entscheidungen auch deutscher Unternehmen mitzukontrollieren. Auch dies ist eine Folge der Zerschlagung (im Jargon der Politik: »Entflechtung«) der »Deutschland AG«, zielstrebig als »finanzpolitische Deregulierung« betrieben von der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer, der heute als transatlantischer Netzwerker unterwegs ist. Seitdem sind 80 Prozent der DAX-Werte im Streubesitz und werden auf dem Kapitalmarkt frei gehandelt. Oft genügt es, wenn ein Fonds Anteile im einstelligen Prozentbereich hält, um Einfluß zu nehmen.
Die drei ETH-Autoren nehmen Bezug auf Max Weber, der als erster darlegte, daß Macht durch Beziehungen ausgeübt wird. So stellt Weber in seinem Werk Wirtschaft und Gesellschaft (1921) fest: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen.« Macht wandelt sich in Herrschaft um, wenn folgende Konstellation eintritt: »Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu fnden.« Dabei spielt das »Netzwerkkapital«, wie es die bereits angesprochene Sandra Navidi nennt, worunter »Status, Reputation und das Transaktionspotenzial des sozialen Kapitals fallen«, eine zentrale Rolle, weil es »direkt mit fnanziellem Gewinn und Macht« korreliert. So entstehen im Zuge der Selbstorganisation eines Netzwerks »Super-Hubs«, die die am »besten vernetzten Knotenpunkte im Zentrum des Finanznetzwerkes« darstellen. Alle anderen Knoten strömten nach Navidi in dem Bedürfnis, anzudocken, auf den »Super-Hub« zu. »Super-Hubs« bewegten mit ihren Entscheidungen täglich Billionen auf den Finanzmärkten und nähmen damit Einfluß auf ganze Industriezweige, Arbeitsplätze oder Wechselkurse. Der Mikrokosmos ihrer Macht oszilliere zwischen dem Weltwirtschaftsforum in Davos, IWF-Treffen, den Bilderberg-Konferenzen, Denkfabriken, Benefizgalas und Glamour-Partys.
Diese Netzwerkdynamik tendiert dazu, daß mächtige Lobby-Gruppen enormen Einfluß auf den Staat ausüben; sie versuchen eine »Herrschaft der informellen Seilschaften«, wie es Hermann Ploppa nennt, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft durchzusetzen. Womöglich ist das der Grund dafür, warum es Netzwerker wie Friedrich Merz nicht mehr »juckt«, politisch wieder »mitzumischen«. Abgeordneter zu sein, so Merz in einem Interview mit dem Nachrichtensender n‑tv, werde »immer schwieriger«, die »Themen immer komplizierter«. Es sind aber wohl nicht vorrangig die Themen, die immer »komplizierter« werden, sondern der Druck informeller Seilschaften und deren Versuche, politische Entscheidungsträger in ihrem Sinne einzukokonieren, die das Abgeordnetendasein immer »schwieriger« machen. Es ist, Merz als künftiger BlackRock-»Berater« wird es wissen, mittlerweile allemal lukrativer, als Lobbyist Netzwerkarbeit zu betreiben, als sich als Abgeordneter an »komplizierten Themen« abzuarbeiten und dabei womöglich auch noch deutschen Interessen zu folgen.