Hier zeigt sich, wer die „Diskurshegemonie“ innehat und ausübt. Seit Jahrzehnten ist es das linksliberale Milieu, das mehr oder weniger uneingeschränkt darüber entschieden hat, wo aus seiner Sicht die Grenzen der Meinungsfreiheit zu verorten sind und wann es Zeit ist, einen unbotmäßigen Diskursteilnehmer im Sinne der „befreienden Toleranz“ Marcuses mit Intoleranz zu begegnen.
Seit einiger Zeit aber ist festzustellen, daß diese Diskurshegemonie brüchiger wird; ihre Ausgrenzungsmechanismen werden selbst Gegenstand der Kritik, siehe aktuell die auch im „Mainstream“ kritischen Reaktionen auf die Distanzierung des Suhrkamp Verlages von seinem Autor Uwe Tellkamp.
Der „Gesinnungskorridor“, von dem die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen in einem Offenen Brief sprach, wird breiter für Positionen, die sich den bestens geölten linksliberalen Sprachspielen nicht oder nicht nicht mehr unterwerfen wollen. Seit geraumer Zeit ist es en vogue, diese Positionen als „Populismus“ zu denunzieren. Populisten, so weiß zum Beispiel Tobias J. Knoblich, Kulturdirektor der Stadt Erfurt und Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, wünschten sich angeblich „einfache Antworten auf komplexe Herausforderungen“, die sich auch „lautstark artikulieren möchten“.
Dieser „heterogene Kreis“ eher „konservativer Menschen“ habe sich der AfD zugewandt. Knoblich zeichnet die AfD in ein Narrativ ein, für das sich im Suhrkamp Verlag auch ein Buch findet; es trägt den beziehungsreichen Titel „Die große Regression“. Das Buch dokumentiert vor allem eines: linke Präpotenz und den Willen, das über lange Zeit hinweg eingeübte, in sich geschlossene System der Verständigung aufrechtzuerhalten.
Für Kulturfunktionäre wie Knoblich reicht die in diesem Buch von einer Internationale von Intellektuellen dargereichte Deutung, daß Parteien wie die AfD „Teil einer regredierenden Kulturbewegung“ seien, „die die Globalisierung zurückdrehen“ wollen und mit den „Konsequenzen unserer weltweiten Vernetzung … nicht umgehen“ könnten.
Interessant sei nach Knoblich – was auch sonst – der Vergleich mit dem Nationalsozialismus. Auch wenn man die Anhänger der AfD nicht „pauschal mit Nazis gleichsetzen“ dürfe, fielen deren „schlichte und auf Illusionierung angelegte Narrative auf“.
Knoblich führt als Sekundanten für seine Behauptungen den Soziologen Hartmut Rosa ins Feld, der die These aufstellte, daß die „Politik der Nazis“ „keine Antwortbeziehung zur Welt“ gestiftet habe, sondern „nur eine Echokammer für eine imaginierte Volksgemeinschaft“. Auf ähnliche Art und Weise inszeniere die AfD-Kulturpolitik nach Knoblich „Echokammern“, die einen reinen „Kollektivkörper [zu] imaginieren“ und die „Beziehung zur Welt“ zu kappen trachteten.
Weinerlich beklagt der Kulturfunktionär, daß sich „Kulturpolitiker/innen in den letzten Jahrzehnten intensiv bemüht“ hätten, „Multi‑, Trans- und Interkultur zu definieren“ und „starre Identitätsbilder aufzubrechen“, und nun komme die AfD (oder auch andere „populistische Strömungen“) und beuge den von Bassam Tibi „europäisch gedachten“ „Topos Leitkultur“ zu einem „deutsch-nationalen Exklusionsmodus“. Was für Verwerfungen in Deutschland zu dem geführt haben, was hier als „Regression“ umschrieben wird, ist bei Knoblich bezeichnenderweise nicht Teil seiner Betrachtungen.
Tiefer in die möglichen Hintergründe der „populistischen Revolte“ dringt der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel ein, der einen tiefen Graben zwischen Kosmopoliten und denen, die er als „Kommunitaristen“ bezeichnet, sieht.
Der Kosmopolitismus sei seiner Meinung nach durch drei Prinzipien gekennzeichnet, nämlich durch „Individualismus, Universalismus und Offenheit“. Entsprechend präferierten Kosmopoliten „individuelle Rechte, erleichterte Einbürgerung, kulturellen Pluralismus“ etc. Die Kommunitaristen hingegen stünden für „überschaubare Gemeinschaften“, „kontrollierte Grenzen“, Beschränkung der Zuwanderung, „kulturelle Identität“ und den „Wert des sozialen Zusammenhalts“.
Den gegenwärtigen Rechtspopulismus charakterisiert Merkel als „negativ-chauvinistische Form“ des Kommunitarismus. Kosmopoliten fänden sich in den Ober- und in den gebildeten Mittelschichten, vor allem aber auch in den Spitzenpositionen von Wirtschaft, Staat, Parteien und Medien.
Aufgrund ihres Bildungshintergrundes seien Kosmopoliten in der Lage, mit kulturellen Unterschieden umzugehen (zu ergänzen wäre hier, daß diese Klientel in der Regel genug Geld verdient, um diesen Unterschieden gegebenenfalls aus dem Weg zu gehen …). Überträgt man dieses Deutungsmuster auf die deutsche Parteienlandschaft, dann verträten die Grünen „am stärksten kosmopolitische“ und die AfD am „deutlichsten kommunitaristisch-chauvinistische Positionen“.
Im gleichen Maße, wie der kosmopolitische zum herrschenden Diskurs geworden sei, wurde die Kritik an ihm „moralisch delegitimiert“, was den Rechtspopulisten zum Bedauern Merkels den Kampfbegriff „politische Korrektheit“ in die Hände gespielt habe. Durchaus selbstkritisch kommt der Berliner Politologe zu der Einsicht, daß „öffentliche Diskurse“, wenn sie demokratisch sein wollten, nicht aus‑, sondern einschließen müssen.
Täten sie das nicht, formten sie „eine kulturelle Hegemonie“, die, wie Antonio Gramsci gezeigt hat, die „Gedanken der Herrschenden zu den herrschenden Gedanken“ mache. Die Kosmopoliten seien „selbstgefällig, behäbig und taub“ gegen die „da unten“ geworden. Arbeiterschaft und „untere Schichten“ wanderten deshalb in Heerscharen zu den Rechtspopulisten ab.
Merkel dringt dann zum Kern des Problems vor, wenn er daran appelliert, daß bestimmte kommunitaristische Positionen wie der „demokratische Wert des Nationalstaates, die Tradition oder der Verlust der vertrauten heimatlichen Lebenswelt“ nicht als „moralisch insuffizient aus unseren Debatten“ ausgegrenzt werden dürften.
Der immer breitere Graben zwischen den kosmopolitisch gestimmten, vorwiegend urbanen Eliten und dem Empfinden der „Normaldeutschen“ steht auch im Mittelpunkt der Deutungsversuche des Kultursoziologen Andreas Reckwitz, der auf den Kulturbegriff aufsetzt, den die UNESCO 1982 sehr weit gefaßt hat, nämlich daß hierunter nicht nur Literatur, Musik oder Kunst zu verorten seien, sondern auch „Lebensformen, die Grundrechte der Menschen, Wertesysteme, Traditionen und Glaubenseinrichtungen“.
In Abwandlung der Thesen von Samuel Huntington, der einen Kampf zwischen religiös geprägten Kulturkreisen prognostizierte, sieht Reckwitz einen Kampf verschiedener Kulturverständnisse; er spricht von einem „Kampf um die Kultur“. In der „Zeit“ vom 15. Dezember 2016 stellt Reckwitz zum Beispiel fest:
„Was wir beobachten, ist kein simpler Kampf zwischen den Kulturen, sondern ein Kampf um die Kultur, ein Konflikt um den Stellenwert, den die Gesellschaft der Kultur zuschreibt, und die Frage, wie sie mit dem umgeht, was wir Kultur nennen. Hier stehen nicht unendlich viele, sondern genau zwei gegensätzliche Fassungen von Kultur miteinander im Widerstreit: die Hyperkultur und der Kulturessenzialismus.“
Was Merkel als Auseinandersetzung zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus faßt, ist bei Reckwitz der Widerstreit zwischen Hyperkultur und Kulturessenzialismus. „Diversität“ und „Kosmopolitismus“ seien Leitbegriffe der Hyperkultur. „Diversität“ sei aus Sicht der Kosmopoliten positiv besetzt, weil sie den „Raum der kulturellen Ressourcen ausdehnt und zu ‚bereichern‘ verspricht“. Ihre Träger lebten im urbanen Bereich, Kultur verstünden sie im Sinne eines Gewährenlassens, in der die Burka als „Identitätsmarker“ neben den Tattoos der „Hipster“ steht.
In scharfer Absetzung dazu steht der Kulturessenzialismus für eine „Kultur der Identität“, der die Vertreter der „Hyperkultur“ in den Modus eines Kampfes „zwischen der offenen Gesellschaft und ihren Feinden“ wechseln lasse. Reckwitz kommt zu dem Schluß, daß die „Spätmoderne“ durch „einen Konflikt dieser beiden Kulturalisierungsregimes gekennzeichnet [ist], die in einer widersprüchlichen Konstellation von Öffnung und Schließung münden“.
Auf der einen Seite steht zugespitzt das „Plädoyer für eine kulturelle Weltinnenpolitik“, das Oliver Scheytt, Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, in seiner Begrüßungsrede auf dem 9. Kulturpolitischen Bundeskongreß im Juni 2017 hielt, und auf der anderen Seite die Behauptung des Rechts auf kulturelle Differenz.
Das Lauterwerden der Stimmen derjenigen, die dieses Recht im öffentlichen Diskurs offensiv vertreten, zeigt, daß das Kulturalisierungsregime der Hyperkulturalisten auch in Deutschland an seine Grenzen gekommen ist und der „Kampf um die Kultur“ voll entbrannt ist.
Ein Grund hierfür sind unter anderem die Folgen der verantwortungslosen Migrationspolitik der Regierung Merkel, der nun eine unheilvolle Neuauflage beschert wird. Die „große Regression“, die oben von Tobias J. Knoblich so wortreich beklagt wurde, ist womöglich die letzte Chance, die Eigenart der über Jahrhunderte gewachsenen nationalen Kulturen Europas zu bewahren.
Im Vergleich zu anderen Ländern, wo die „regredierenden“ Strömungen schon deutlich weiter sind, zeigt sich Deutschland wohl nicht zuletzt aufgrund seiner jüngeren Vergangenheit in dieser Frage als „verspätete Nation“.
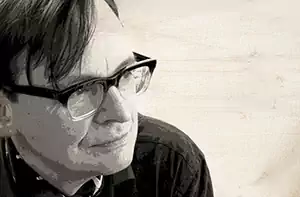
quarz
Zwei Anmerkungen:
1) "nur eine Echokammer für eine imaginierte Volksgemeinschaft ... daß sich „Kulturpolitiker/innen in den letzten Jahrzehnten intensiv bemüht“ hätten, „Multi-, Trans- und Interkultur zu definieren“
Was real und was nur imaginiert (bzw. definiert) ist, zeigt sich an den Wirkungszusammenhängen. Der Begriff der (graduellen) ethnischen Homo- bzw. Heterogenität wurde sozialwissenschaftlich in verschiedenen Varianten definiert mit anderen Begriffen in Zusammenhang gebracht. Und dabei hat sich eine (gerade für die Sozialwissenschaften) erstaunliche Hartnäckigkeit der empirischen Realität gezeigt: Ethnische Heterogenität korreliert mit vielen Merkmalen, die für eine Gesellschaft schädlich sind. Kurz: die gesellschaftliche Schädlichkeit von Multikulti ist auch für diejenigen wissenschaftlich erwiesen, die behaupten, sie in ihrer Alltagserfahrung nicht zu entdecken.
2) Die durch "Diversität" geprägte Kultur ist eine parasitäre kulturelle Lebensform, die sich aus monokulturellen Quellen speist, die ihr die Komponenten ihres Daseins liefern. Indem nun die Diversity-Jünger typischerweise die von ihnen präferierte Gesellschaftsform gegenüber den monokulturellen Formen als höherwertig betrachten, werten sie genau diejenigen ab, die zu achten sie in besonderem Maße vorgeben.