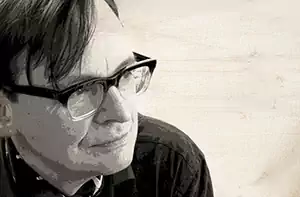Kein Geringerer als der Philosoph Wilhelm Dilthey, der »Vater der Hermeneutik«, urteilte über das Werk von Alexis Comte de Tocqueville, daß er der »Analytiker unter den geschichtlichen Forschern seiner Zeit« sei, »und zwar unter allen Analytikern der politischen Welt der größte seit Aristoteles und Machiavelli«. Es war vor allem eine Arbeit, die Tocqueville bis heute zu einem Begriff macht, nämlich sein in den Jahren 1835 und 1840 in zwei Teilen veröffentlichtes Werk Über die Demokratie in Amerika, das bald auch aus dem Französischen in alle wichtigen europäischen Sprachen übersetzt wurde.
Diese kritische Auseinandersetzung mit der Demokratie, deren Siegeszug er als unumkehrbar ansah, gehört heute zu den Klassikern der modernen Soziologie. Arnold Gehlen und David Riesman etwa erblickten in dem Amerika-Buch Tocquevilles die erste fundierte Analyse der egalitären Massendemokratie. Diese könne zu einem totalitären System entarten, zu einem »Despotismus neuer Art«, dessen Konturen in Anknüpfung an Tocqueville unter anderem der Historiker Jacob Talmon in seinen Arbeiten über die »totalitäre Demokratie« ausbuchstabiert hat.
Als Tocqueville seine subtilen Betrachtungen zu Papier brachte, herrschte der »Bürgerkönig« Louis-Philippe I., der nach der Julirevolution des Jahres 1830 auf den gestürzten letzten Bourbonen Karl X. folgte. Der studierte Jurist Tocqueville, der der Petite noblesse, dem Landadel der Normandie, entstammte, war in dieser Zeit Untersuchungsrichter am Gericht von Versailles. Ende der 1820er Jahre hatte er vom französischen Justizministerium den Auftrag erhalten, das Rechtssystem und die Reformen im Strafvollzug in den Vereinigten Staaten von Amerika zu untersuchen.
Er trat die Reise nach Amerika, die von Mai 1831 bis Ende Februar 1832 dauern sollte, in Begleitung seines Freundes Gustave de Beaumont an, in dieser Zeit Prokurator des Königs am erstinstanzlichen Gericht in Versailles. Tocqueville und Beaumont hatten ihre »gefängniskundliche Amerikareise«, so der Politikwissenschaftler Matthias Bohlender, professionell vorbereitet und führten in den USA ihre Forschungsarbeit zum Beispiel anhand eines vorher erarbeiteten Fragerasters und mit der neuesten Interviewtechnik akribisch durch. Sie rezipierten Statistiken, Berichte und Re- gister, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Ihr gemeinsames, Anfang 1833 veröffentlichtes Gutachten über das amerikanische Gefängniswesen wurde mit dem Prix Montyon der Académie française ausgezeichnet.
Dieses professionelle Vorgehen verdient deshalb eine etwas nähere Betrachtung, weil es auch Rückschlüsse auf ihre Urteilsfähigkeit im Hin- blick auf die damals noch junge amerikanische Demokratie zuläßt, der ihr Privatinteresse galt. Er habe dort, so Tocqueville, ein Bild der reinen Demokratie gesucht: »Ich wollte sie kennenlernen, und sei es nur, um we- nigstens zu erfahren, was wir von ihr zu erhoffen oder zu befürchten haben«. Beaumont und Tocqueville hatten die Ära der Präsidentschaft Andrew Jacksons (Stichwort: Jacksonian democracy) vor Augen, in der Handel und Industrie boomten und die USA am Beginn einer ausgreifenden Phase der Expansion standen, die die Grenze (Frontier) nicht nur geographisch, sondern auch industriell und demokratisch immer weiter verschob.
Jacksons Präsidentschaft wurde eher zwiespältig beurteilt, der Politiker als politischer Taschenspieler, aber auch als bürgernaher Politiker charakterisiert, in den insbesondere die »kleinen Leute« Vertrauen setzten.
Die beiden Franzosen trafen etliche Amerikaner von Rang und Namen; Tocqueville fertigte über diese Begegnungen bis hin zu wortwörtlichen Zitaten Aufzeichnungen an, und nicht nur Persönlichkeiten des »Establishments« in den Städten gehörten zu seinen Gesprächspartnern, sondern auch Siedler, Fallensteller oder Indianer. Seine Eindrücke legte er 1831 in dem Buch Quinze jours au désert (dt. In der nordamerikanischen Wildnis [1953] bzw. Fünfzehn Tage in der Wildnis [2013]) vor. Er porträtiert einen »kalten und leidenschaftlichen« Menschenschlag, »der mit allem handelt, Moral und Religion nicht ausgenommen; ein Volk von Eroberern«, das von einem Ziel besessen ist, nämlich dem »Erwerb von Reichtum«.
Ende Februar 1832 trafen Beaumont und Tocqueville wieder in Frankreich ein und legten in der Folge ihre richterlichen Ämter nieder. 1835 erschien dann der erste Teil der Démocratie en Amérique – das Buch gilt als Hauptwerk Tocquevilles und machte ihn mit einem Schlag bekannt. Im selben Jahr veröffentlichte er im übrigen auch eine Arbeit über Das Elend der Armut, die heute zu den Klassikern der Armutsforschung gezählt wird. Er geht hier das Phänomen der Massenarmut im Zuge der einsetzenden Industrialisierung mit der gleichen intellektuellen Schärfe an, die in seine berühmten Schriften auszeichnet, und beweist einmal mehr erstaunliche Weitsicht, wenn er kritisch die Folgen der gesetzlichen Armenunterstützung reflektiert, deren Effekte er zwiespältig beurteilt.
Tocqueville blieb nicht nur distanzierter Beobachter der politischen Verhältnisse: 1839 wurde er Mitglied der Nationalversammlung, nach der Februarrevolution 1848 Mitglied der Kammerkommission für die neue republikanische Verfassung und im Sommer 1849 war er sogar für fünf Monate Außenminister Frankreichs. Größere politische Spuren indes hinterließ er nicht; er selbst bekannte, als Denker »mehr wert« zu sein denn als »Täter«. Die letzten Jahren seines Lebens – er verstarb 1859 in Cannes – widmete er seinem unvollendet gebliebenen Alterswerk Der alte Staat und die Revolution, dessen erster Teil 1856 veröffentlicht wurde; die Arbeit gilt als erste soziologische Untersuchung zum Ancien régime. 34 Jahre nach seinem Tod erschienen 1893 Tocquevilles Erinnerungen, die vor allem um die Revolution von 1848, ihre Vorgeschichte und die Gegenrevolution kreisen. Zum Rang dieser nachgelassenen Aufzeichnungen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren, schrieb Carl Schmitt, man erkenne Tocqueville am besten »in seinen Souvenirs«: Kein Historiker habe »etwas ähnliches aufzuweisen wie Tocqueville mit diesem wundervollen Buch.« Auch dieser Nachlaß unterstreicht seinen Rang als scharfsinniger Beobachter der Zeitläufte, der auch winzigste Wahrnehmungsdetails reflektiert.
Die egalitäre amerikanische Demokratie, die Anfang der 1830er Jahre noch aus 24 Einzelstaaten bestand, faßte Tocqueville als eine Art Idealtyp der Demokratie auf, gelang es hier doch zum ersten Mal in der Geschichte, eine Demokratie in einem großen Flächenstaat zu etablieren, ein Gegenmodell zur alten ständischen Ordnung in Europa. Der Fokus der Betrachtung lag bei Tocqueville auf der Frage, was die französische Elite von der Demokratie in Amerika lernen könnte, um stabile Verhältnisse in Frankreich herstellen zu können.
Bürgerliche Gleichheit, freie Wahlen der Repräsentanten des Volkes, das Engagement der Bürger in öffentlichen Angelegenheiten und Rechtssicherheit sowie die Frage, »wie der sich im Alltag manifestierende Geist der Gesetze die politische Ordnung prägt« (Karl-Heinz Breier), waren Säulen, die aus seiner Sicht auch in Europa Garanten für Stabilität sein könnten.
Im ersten Buch liefert Tocqueville eine Darstellung der institutionel- len und verfassungsrechtlichen Grundlagen der Demokratie in Amerika, die aufgrund ihrer Verfassung und mittels lokaler Selbstverwaltung einen Ausgleich zwischen der Forderung nach politischer Mitbestimmung und dem Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Privatsphäre herzustellen vermöge. Föderalismus, dezentrale Verwaltung und intermediäre Instan- zen sicherten in Amerika die Freiheit nach innen ab. Hieraus ergeben sich die Vorzüge, die Tocqueville herausarbeitet: Zum einen könnten Fehlent- wicklungen, wie sie der französische Zentralismus hervorgebracht hatte, vermieden werden. Die begrenzte Amtsdauer gewählter Funktionsträger garantiere, daß Fehler korrigiert werden könnten; gegen die Anmaßun- gen der Regierenden gebe es institutionelle Sicherungen, der Bürgergeist werde durch vielfältige politische Teilhabe gestärkt. Nicht zuletzt werde etlichen Bürgern die Möglichkeit eröffnet, zu Wohlstand zu kommen.
Dessenungeachtet kommt Tocqueville auch auf die Schwächen demokratischer Verfaßtheit zu sprechen, in deren Mittelpunkt das volatile Verhältnis von Gleichheit und Freiheit steht. Tocqueville arbeitet damit als einer der ersten, wenn nicht überhaupt als erster heraus, daß die Demokratie (die mit dem Anspruch einhergeht, die freieste politische Ordnung zu sein, da ihre Entscheidungsfindungsprozesse auf der Grundlage der Gleichberechtigung und Gleichgewichtung jeder Stimme fußen) Formen von Unfreiheit ausbilden könne, weil das Regieren im Namen der numerischen Mehrheit auf Kosten der individuellen Freiheit gehen könne:
»Die Gleichheit löst nämlich zwei Tendenzen aus: die eine führt die Menschen geradewegs zur Freiheit und kann sie auch plötzlich in die Anarchie treiben; die andere leitet sie auf längerem, verschwiegerem, aber sicherem Wege in die Knechtschaft.« En passant: Der Staatsrechtslehrer Walter Leisner – neben dem Hohenheimer Emeritus Klaus Hornung einer der rührigsten Tocqueville-Rezipienten im konservativen Spektrum, den Robert Hepp einmal als »deutschen Tocqueville« bezeichnet hat – hat die Konsequenzen des Gleichheitspostulats und seiner machtverstärkenden Effekte unter anderem in seinem (weithin ungelesenen) Buch Der Gleichheitsstaat durchdekliniert.
Schwächen im demokratischen System macht Tocqueville im weiteren auch im Hinblick auf die Führungsauslese aus (kompetente Führungspersönlichkeiten entschieden sich oft gegen eine politische Karriere, um in der Wirtschaft zu reüssieren), in der »fieberhaften Erregung«, die durch häufige Wahlen entstehe, in der Aufblähung der öffentlichen Ausgaben, um sich das Wohlwollen der Wähler zu sichern, im Verfolgen egoistischer Ziele durch kleinere Parteien, die die »Transmissionsriemen des demokratischen Systems für eigene Zwecke« (Oliver Hidalgo) nutzten und vor allem im Sinne von Klientelinteressen agierten, und schließlich im Konformitätsdruck im Denken, der durch die »öffentliche Meinung« erzeugt werde.
Tocquevilles Blick auf die Vereinigten Staaten war mitbestimmt von der Lage in Frankreich, die seit 1789 zwischen Restauration und Revolution oszillierte; nach dem gewaltsam herbeigeführten Ende des absolutistischen Systems konnten weder eine stabile Herrschaftsordnung etabliert noch der Zentralismus eingedämmt oder demokratische Rechte ab- gesichert werden. Der französische Zentralismus, dessen Konturen er vor allem in seiner Arbeit Der alte Staat und die Revolution nachgezeichnet hat, führte dazu, daß der Bürger sich nicht mehr für das Schicksal und die Interessen seiner Gemeinde interessierte und ihm das politische Leben gleichgültig wurde.
Im zweiten Buch unternimmt Tocqueville eine grundsätzliche Untersuchung der Staatsform Demokratie und stellt sie in Beziehung zu den Sitten (Mœurs) der Menschen, die für ihn ein zentraler Faktor im Hinblick auf die Implementierung und Dauerhaftigkeit einer Demokratie darstellen. Ein Großteil des zweiten Bands kreist deshalb um die Bedeutung der bürgerlichen Tugenden, die im Deutschen mit »Sitten« nur unzureichend wiedergegeben werden können. Der Politikwissenschaftler Michael Hereth definiert Mœurs als den »gesamten Kosmos der Denk‑, Verhaltens‑, Debattier- und Interpretationsweisen«, die »konstitutiv für die Eigenheiten einer jeden Gesellschaft« sind. Sie seien entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Stabilität der Demokratie in den USA.
Der christlichen Religion schreibt Tocqueville mit Blick auf die Mœurs eine starke Prägekraft zu, was, wie Hereth herausstreicht, der Verbreitungsfähigkeit demokratischer Ordnung Grenzen setzt. Eine Einsicht, die während so mancher jüngeren US-Präsidentschaft, in der das amerikanische Demokratieverständnis als Art Morgengabe für eine globalisierte Welt betrachtet wurde, übergangen wurde.
Tocqueville leistete auch Pionierarbeit, indem er das Phänomen des Individualismus und der Bindungslosigkeit des Individuums einer ausführlichen Betrachtung unterzog. Der Politologe Oliver Hidalgo hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß Tocqueville die »zunehmende Atomisierung der Bürger« und die »um sich greifende politische Apathie«, die er mit Blick auf die moderne Demokratie diagnostiziert, als »Individualismus« kennzeichnet, der den einzelnen dazu bringe, das Gemeinwesen sich selbst zu überlassen.
Ein Effekt dieses Phänomens besteht in der Übertragung der Lösung politischer und sozialer Probleme auf die Bürokratie. Das wiederum führt zu einem engmaschigen Netz aus Verwaltungsvorschriften, die letztlich jedwede soziale Tätigkeit erfaßten. Je unmündiger aber das Individuum sei, desto größer werde seine Abhängigkeit von der staatlichen Zentralgewalt.
Bei der Erörterung der Frage, welcher Tugenden es bedarf, damit der einzelne seine egoistische Perspektive überwindet, rekurriert Tocqueville vor allem auf die Religion, konkret auf den christlichen Glauben, der einer der Faktoren sei, um eine größere Affinität zum Gemeinwesen herzustellen. Kein demokratisches Gemeinwesen könne auf die Religion als sinnstiftende Quelle der Moral verzichten. Wie Hidalgo herausstreicht, zeige Tocqueville hier nicht nur seine Nähe zu konservativen Köpfen wie Edmund Burke oder Joseph de Maistre, sondern argumentiere auch analog zum bekannten Diktum von Ernst-Wolfgang Böckenförde, wonach der liberaldemokratische Staat von Voraussetzungen lebe, die er selbst nicht garantieren könne.
Welchen Weg eine Demokratie letztlich nimmt, ob in Richtung Freiheit oder Despotismus, hängt nach Tocqueville also auch von der Frage ab, ob es ihr gelingt, den Individualismus einzudämmen oder nicht. Diese Alternative führt zu der zentralen Einsicht, daß derjenige, der »nicht gläubig« sei, »hörig« werde, und derjenige, der »frei« sei, »gläubig sein muß«. Ohne Religion mag sich, so resümiert Oliver Hidalgo, weder eine Vermittlung zwischen privaten und politischen Interessen noch ein Zusammengehörigkeitsgefühl einstellen.
Als »vorpolitischer Glaube« (Hidalgo), der auf die Sitten und das Verhalten der Bürger einwirke, könne die Religion – Tocqueville läßt hier im übrigen eine eindeutige Präferenz für den hierarchisch geprägten Katholizismus gegenüber dem eher individualistisch ausgerichteten Protestantismus erkennen – auch auf das Agieren der politischen Protagonisten einwirken. Ohne das Korrektiv der Religion besteht die Gefahr, daß die Entwicklung immer weiter in Richtung »despotischer« Verwaltung voranschreitet, die im Zusammenspiel mit der »öffentlichen Meinung« mehr und mehr letzte Autorität beansprucht.
Der Leser mag an dieser Stelle entscheiden, wie er diesen Befund ausfüllt. Anschauungsmaterial liefert zum Beispiel die Regulierungswut der EU-Bürokratie bis hin zur berühmten Krümmung der Gurke, aber auch die Rundumbetreuungsmaschine, die sich deutscher Staat nennt, der dem Bürger sogar vorschreibt, wie er »richtig«(= politisch korrekt) zu denken, schreiben und wählen hat.