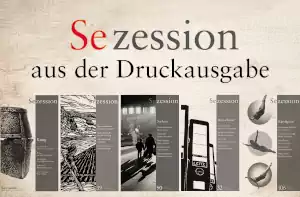»Republik« als »Rzeczpospolita«, als die »gemeinsame Sache«: Das ist in Polen seit der frühen Neuzeit und bis heute jener Begriff der eigenen Staatlichkeit, der sozusagen das gewisse Etwas zum Ausdruck bringt – ein Wort also, in dem sich die Nation über die bloße Beschreibung dieses oder jenes Verfassungszustands hinaus auch emotional beschrieben sieht.
Einen solchen Begriff gibt es nicht in jedem Land, und er ist auch nicht unwandelbar. In Frankreich konnte sich nach 1789 in jahrzehntelangen zähen politischen Auseinandersetzungen ebenfalls »Republik« an diese Stelle setzen. In Deutschland hat diese Rolle seit jeher und bis 1945 der Begriff »Reich« eingenommen. Dieser beschrieb ebenfalls nicht nur die politischen Zustände im Land, sondern auch eine zur Gewohnheit gewordene Selbstverständlichkeit staatlicher Existenz, die dann 1806 verlorenging. Mit dem Beginn der Teilungen Polens vor 250 Jahren hatte eine Ära begonnen, in der Staaten fast nach Belieben auf dem Spiel standen.
Die polnische »Rzeczpospolita«, die genaugenommen ein vom Adel betriebenes polnisch-litauisches Gemeinwesen (Rzeczpospolita Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) gewesen ist, wurde 1772 bis 1795 in drei Etappen unter den Nachbarstaaten Preußen, Österreich und Rußland aufgeteilt. Eine polnische Staatlichkeit blieb nur noch im russischen Teilungsgebiet andeutungsweise erhalten, bis auch sie im Laufe des 19. Jahrhunderts kassiert wurde.
Die innerpolnischen Folgen gestalteten sich wenigstens unter einem Aspekt durchaus ähnlich wie in Deutschland. Was der Nation verlorengegangen war, sollte nach deren Willen auch in Polen wiederhergestellt werden: der Staat und die Einheit. Der Begriff der Republik wuchs sich dabei zum Ideal aus – eine Entwicklung, die zusätzlich von der noch kurz vor Toresschluß am 3. Mai 1791 verabschiedeten Verfassung verstärkt wurde. Da man im revolutionären Frankreich dieses Jahres noch in Verfassungsdebatten verstrickt war, die erst im Herbst desselben Jahres zu einem Abschluß kamen, konnte die polnische Verfassung seitdem als erste »moderne«, von einem Parlament verabschiedete Verfassung Europas gelten.
Das gefiel dem polnischen Nationalstolz, der künftig Jahr für Jahr am Verfassungstag des 3. Mai feierlich daran anknüpfte, was regelmäßig den Eindruck verstärkte, von der Geschichte und den Nachbarstaaten ungerecht behandelt worden zu sein. Naturgemäß verboten die Teilungsmächte diese Feiern. Erstmals landesweit öffentlich konnten sie deshalb nach langer Unterbrechung 1916 wieder gefeiert werden, als die deutschen Streitkräfte die russischen aus Polen hinausgeworfen hatten. Die deutsch-österreichische Militärverwaltung duldete solche Feiern als große Geste der Befreiung im Generalgouvernement – während sie den Polen in Deutschland immer noch verboten blieben. Dem deutsch-polnischen Verhältnis hat das schon damals wenig geholfen, zumal in dieser Kombination.
Für die polnischen Teilungen gab es natürlich aber auch interne Gründe. Die inneren Verhältnisse der polnischen »Adelsrepublik« galten bereits den Zeitgenossen in den Jahrzehnten davor als Paradebeispiel dessen, was man mit dem modernen Begriff »failed state« bezeichnen würde. Es ist relativ unbestritten, daß die Entwicklung hierzu schon Jahrhunderte vorher ihren entscheidenden Sprung genommen hatte. 1564 verwandelte sich die polnische Monarchie in eine Wahlmonarchie und billigte faktisch jedem einzelnen Adligen ein Vetorecht (liberum veto) bei künftigen Reichstagen zu. Das galt für eine mit etwa zehn Prozent der Bevölkerung recht umfangreiche Personengruppe. Es konnte nicht gutgehen und machte das Land schließlich führungslos.
Keine der großen polnischen Familien konnte sich in der Folgezeit dauerhaft als Herrscherhaus etablieren. Im Gegenteil wählte sich der Adel frühzeitig immer wieder nichtpolnische Könige. Bereits die erste polnische Königswahl im Zeichen dieser neuen Verhältnisse fiel 1573 angesichts eines ansonsten drohenden Bürgerkriegs nicht auf einen Polen, sondern auf den Franzosen Heinrich III. Auch künftig wich die Wahlversammlung immer wieder ins Ausland aus und wählte ungarische Könige oder deutsche Kurfürsten aus dem sächsischen Haus der Wettiner zu polnischen Königen.
Soziologisch gesehen, drückten sich diese Ereignisse in einer Art dauerhafter Verländlichung des Adels und damit des politischen Lebens aus, die dieser selbst als Stil des »Sarmatismus« begriff. Der polnische Adel führte dabei seine Abstammung auf die in antiken Quellen erwähnten Sarmaten zurück, deren genauer Wohnsitz in Osteuropa bei Herodot und Ptolemäus allerdings nicht eindeutig zu identifizieren ist. In der frühen Neuzeit kam dieses Selbstverständnis dann in Polen, Litauen und Weißrußland mit der Erschließung antiker Autoren zusehends in Mode. Während man in Deutschland auf dem Regensburger Reichstag von 1471 erstmals die Germania von Tacitus präsentierte, in der sich die Deutschen künftig so treffend beschrieben sahen, brachten die seit 1464 erscheinenden lateinischen Ausgaben der Schriften des römischen Gelehrten Claudius Ptolemäus den Durchbruch des »Samartismus«.
An sich stellte die Berufung auf antike Herkunft im Europa der damaligen Zeit keine Besonderheit dar. Im Fall Polens trug sie allerdings dazu bei, das Land in ausgesprochener Selbstzufriedenheit politisch erstarren zu lassen. Im Jahr 1538 wurde der Grundbesitz zu einem faktischen Monopol des Adels. Der sarmatische Adel saß danach auf seinen Gütern und lebte von deren Ertrag, ohne weiter groß zu investieren. Gab es nicht genug Ertrag, nahm man eben den nächsten Kredit auf. Die Städte dagegen stagnierten oder verödeten. Es entstand, was als »polnische Wirtschaft« besonders in Deutschland sprichwörtlich wurde.
Gleichwohl sah die polnische Adelsschicht von dieser provinziellen Warte aus mit einer gewissen Arroganz nicht nur wie andernorts auf den Rest der Bevölkerung herab, sondern auch auf die Nachbarstaaten. In denen ließ es sich für den Adel angeblich oder tatsächlich weniger gut leben, als er dies im polnisch-litauischen Staat für angemessen befand. Dieser Staat nahm sich auf der Landkarte zudem wie ein stattliches Imperium aus, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte. Ein Umstand, der für die innerpolnischen Vorstellungen von eigener angemessener Größe dauerhaft wirksam wurde, mit denen Europa in den Jahren zwischen 1919 und 1939 wieder konfrontiert werden sollte. Entsprechend harsch fiel das Urteil späterer polnischer Autoren über diese Phase aus, als »die Sarmaten sich schließlich zu Tode logen« (Jan Błonski).
Denn wo ein machtpolitisches Vakuum besteht, wird es gewöhnlich eher früher als später gefüllt. So hatten die polnischen Teilungen auch eine längere Vorgeschichte politischer Entmündigung und ausländischer Eingriffe, besonders in den stets fragilen Prozeß der Königswahl. Als entscheidender Faktor erwies sich der ständige russische Drang nach Westen seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts, als sich Rußland unter dem Zaren Peter I. (dem Großen) zunächst einmal einen breiten Raum an der östlichen Ostseeküste eroberte. Im Zarenreich waren alle ständischen, adligen und sonstigen Freiheiten zugunsten des Alleinherrschers umfassend beseitigt worden und standen einer Eroberungspolitik nicht im Weg.
Während des Großen Nordischen Krieges (1700 –1721), der in der Frage der Ostseeküste zwischen Rußland und Schweden die Entscheidung brachte, geriet die ganze polnische Monarchie zwischen die Fronten. Mit dem Wechsel des Kriegsglücks wechselten die Throninhaber. Schon 1733 kam es über die polnische Königswahl wiederum zu einem veritablen europäischen Großkrieg, in dem Rußland und das Reich deutscher Nation gegen Frankreich standen, das einen polnischen König seiner Wahl durchsetzen wollte. Neben Polen wurden dabei für zwei Jahre auch das Rheinland und Italien zu Kriegsschauplätzen, während in Warschau unter Verhinderung französischer Landungsversuche und starker russischer Militärpräsenz wieder einmal ein Sachse zum polnischen König gewählt wurde: August III.
Die innerpolnischen Reformversuche, die in der Verfassung von 1791 nicht nur eine parlamentarische Monarchie einführten, sondern zusätzlich auch die Königswahl abschafften, erwiesen sich als vergeblicher Versuch, dem Staatstod noch von der Schippe zu springen. Seit langem an die Rolle Polens als eines politischen Spielballs gewöhnt, wollten die Nachbarstaaten diesen Einfluß nicht verlieren. In einer wendungsreichen Entwicklung trugen die Reformversuche dann zum Entschluß der Teilungsmächte bei, Polen lieber ganz zu zerstören, als reformiert bestehen zu lassen.
Obwohl man, wie gesagt, den russischen Eroberungsdrang letztlich als die Hauptursache für die polnischen Teilungen sehen muß und Rußland sich auch das größte Stück des Kuchens sicherte, vergrößerte unter den Teilungsmächten Preußen prozentual am stärksten sein Gebiet. Neben der Eroberung Schlesiens waren es die Teilungsgewinne zwischen 1772 und 1795, die aus dem Kurfürsten von Brandenburg und König »in« Preußen den Regenten über eine europäische Großmacht werden ließen. Das trug dazu bei, daß sich in der Folgezeit nicht nur eine polnisch-russische Feindschaft, sondern auch ein neuer polnisch-deutscher Gegensatz entwickelte. Jede Wiederherstellung Polens mußte »Preußens beste Sehnen« bedrohen, so Otto von Bismarck.
Als Preußen sich 1795 daran beteiligte, die polnische Rzeczpospolita endgültig einzureißen, beschädigte es nicht nur die Legitimität der europäischen Staatenwelt. Es trug auch mit dazu bei, einen Feind zu schaffen, der »gieriger als der russische Kaiser« sei, so Bismarck weiter über die polnische Mentalität. An letzterem mag man trotz allem zweifeln.