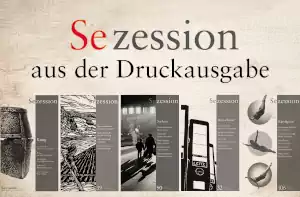Pädagogik läßt sich weder von einem Ziel (Ethos) noch einem transzendentalen Grund oder einer weltanschaulichen Prädisposition als Wissenschaft herleiten, sondern nur aus der Konkretion, der historischen und der anthropologischen, auf dem Feld der Empirie. Es war die geisteswissenschaftliche Pädagogik (Schleiermacher und Dilthey), die diesen Begründungszusammenhang erkannte und ein methodisches Besteck zur Verfügung stellte, ihn produktiv zu bearbeiten.
Diltheys bahnbrechende Einsicht war, daß das Leben sich nur aus dem Leben, daß die menschliche Ingeniosität sich nach inneren und nicht primär nach naturgesetzlichen Zwängen erklären läßt und also historisch-anthropologisch darzulegen ist. Die von ihm entwickelte erkenntnisleitende Methode der Hermeneutik steht am Beginn auch der pädagogischen Anthropologie, die sich über das weitverstreute Werk des Pädagogen Herman Nohl vor allem in Otto Friedrich Bollnows (1903 – 1991) Schaffen materialisierte und dort in viele verschiedene Richtungen ausdifferenziert wurde.
Allerdings war Bollnow kein historisches Glück beschieden. Die frühen Arbeiten entstanden in den dunklen Jahren und stehen nun unter dem Verdacht der Kontamination, die späteren Texte wurden von der Wucht des 68er Kulturbruches überrannt und sind seither aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Eine kleine Schar an Schülern gründete eine Bollnow-Gesellschaft und legte in einer vorbildlichen Edition in zwölf Bänden die wesentlichen Bücher Bollnows neu auf – ein Schatz, den es zu heben gilt!
Was aber heißt »pädagogische Anthropologie«? Zum einen kann es die Hereinholung der Erkenntnisse jener Wissenschaften in die Pädagogik bedeuten, die sich dem Menschen aus spezifischem Blickwinkel nähern, etwa Medizin, Biologie, Psychologie, Soziologie und Ethnologie. Unter diesem Blickwinkel hatte 1966 Heinrich Roth begonnen, seine gewichtige Pädagogische Anthropologie (1) zu veröffentlichen.
Die hier zu besprechende Bedeutung meint jedoch die denkerische und methodische Aufnahme der Erkenntnisse der damals noch jungen Philosophischen Anthropologie (Scheler, Plessner, Gehlen) in den pädagogischen Aufmerksamkeitsbereich. Diese Anthropologie war aus der Krise der Philosophie, aus der Diskrepanz zwischen der abstrakten rationalen Durchdringung und einer technischer werdenden Welt entstanden. Von dort her wurden die kulturellen Phänomene auf ihre wechselseitige menschliche Funktionalität und Kompatibilität befragt, also nach der Wie-Beschaffenheit des Menschen, der in den Institutionen sein, leben und weben kann, als »Organon«, wie Plessner das nannte, oder über das Verstehen der menschlichen »Objektivationen« (2) nach Dilthey.
Bollnow nun versuchte diese Engführung Plessners und Gehlens auszuweiten und machte sich dabei vor allem zwei philosophische Ansätze der Zeit zunutze – sie sollten ihn lebenslang als Richtlinie und als Schleifstein begleiten: Lebensphilosophie und Existenzphilosophie, Dilthey und Heidegger. Der eine war sein geistiger Lehrer, ihm galt seine erste große eigenständige Arbeit; (3) beim zweiten belegte er drei Semester in Freiburg und Marburg. Sein anderes frühes Hauptwerk (4) ist in Fragestellung und Sprache deutlich an Heidegger angelehnt und wird auch heute noch im grauen Look des Klostermann-Verlags vertrieben.
Noch hatte Bollnow sich nicht explizit zur Erziehung geäußert. Die Arbeiten an einer Geschichte der Pädagogik blieben Fragment und wurden erst nach dem Krieg veröffentlicht, (5) aber schon war zweierlei zu erkennen: die kritische Absetzung von seinem übermächtigen Lehrer und der Versuch, solch vage Entitäten wie Stimmungen, Gefühle und Tugenden nicht nur abstrakt-philosophisch, sondern auch praktisch für die erzieherische Theorie fruchtbar zu machen.
Das setzte eine gewisse Positivität voraus, weshalb Bollnow von den Stimmungen »als tragendem Grund der Seele« sprach. Die Suche nach dem Tragenden und Bergenden oder dem Geborgenheit Bietenden blieb ein Lebensthema Bollnows. Die Kälte des philosophischen Begriffes der »Existenz«, dieser nackte »innerste Kern des Menschen« wurde in seiner historischen Notwendigkeit der beiden Nachkriegsgenerationen zwar anerkannt und ausgiebig gewürdigt (6)– als Ausdruck der Krise der Gegenwart –, aber Bollnow scheute die lebensweltlichen Konsequenzen von Desillusionierung, Aussichtslosigkeit und Verlassenheit.
Er weitete diese distanzierte Faszination später auch auf den französischen Existentialismus aus, (7)wie es ihm immer um ein Darüber-Hinauskommen ging. Die Existenzphilosophie lehnte die Anthropologie aus ihren Grundlagen heraus ab, weil Mensch-Sein ein ununterbrochen schaffender Prozeß sei, und mehr als »Existenzerhellung« (Jaspers) könne nicht geleistet werden. Bollnows Anthropologie hingegen kritisiert die Existenzphilosophie aus den düsteren Folgen heraus, die jenes positive Sich-selbst-Schaffen eben nicht zuließen. (8)
Als Korrektiv diente ihm die Lebensphilosophie. Dort sah er die Möglichkeit, »den auf die Schattenseite des menschlichen Lebens verengten Blick wieder auf das Ganze des Lebens, auch mit seinen tragenden, förderlichen und erfreulichen Seiten, auszudehnen«, (9) im Spiel von »objektivierendem Ausdruck und fortbildender Deutung« das »Wachstum der Geschichte« nachzuzeichnen, den »Zusammenhang von Leben, Ausdruck und Verstehen«, wie ihn Dilthey entworfen hatte, als »Dynamik des Lebens selbst« (10) zu begreifen.
Wird das Wachstum auf die individuelle Geschichte bezogen, dann bewegen wir uns auf dem Felde der Pädagogik. Die notwendig anzuwendende Methode ist dann die hermeneutische Zirkelhaftigkeit (das Ganze aus dem einzelnen und das einzelne aus dem Ganzen zu verstehen), die man bei Bollnow exemplarisch studieren kann. Nicht nur sind seine meisten Werke hermeneutisch angelegt, auch sein Lebenswerk kreiselt immer wieder um das vorgreifende Verstehen, auf dem aufzubauen und Neuland zu gewinnen sei. Daß Bollnow dabei ganz bewußt auf jegliche Form von Verklausulierung und Akademisierung verzichtet, ist Programm und innere Aussage zugleich – seine Werke zeichnen sich nicht zuletzt durch Zugänglichkeit und den Willen, unzweideutig verstanden zu werden, aus.
Wenn dies nicht immer klappte, dann lag es mitunter an der Boshaftigkeit des Lesers. Exemplarisch steht dafür Adornos Suada in Jargon der Eigentlichkeit, (11) in der er sich berserkerhaft auch auf Bollnows Zentralbegriff der »Geborgenheit« stürzte, dem er vorwarf, einem »meist nicht mehr existenten Alltag« zu entspringen. Das war sachlich nicht gänzlich falsch, wurde es aber durch die Verknüpfung mit dem Vorwurf eines verkappten Nationalsozialismus. Mit diesem Buch hatte Adorno, dem Gedichte »nach Auschwitz« nicht mehr opportun erschienen und dem das Eigentliche innerlich fremd blieb, die Kritische Theorie als Diskursangebot schon vor Erscheinen der Habermasschen kommunikationstheoretischen Utopie begraben.
Bollnow war von der Vehemenz der Kritik ganz offensichtlich beeindruckt und meinte, den mutmaßlich naiven Begriff der »Geborgenheit« zugunsten der »Hoffnung« aufgeben zu müssen. Dabei scheint gerade er heute fruchtbar gemacht werden zu können, wohingegen das »Prinzip Hoffnung« nicht nur durch Blochs Auslegung besetzt ist, sondern auch hohl klingt.
Blochs Begriff der Hoffnung war ein vornehmlich individualistischer, ein Vertrauen in sich, eine Stärkung des Selbst und damit eine treibende Kraft der allgemeinen Akzeleration. Bollnow aber meinte damit das »Angenommenwerden und Aufgefangenwerden von einer anderen Kraft«. (12) Die »neue Geborgenheit« umfaßt die »universale Hoffnung, die Seinsgläubigkeit und das Seinsvertrauen«, die Suche nach allem, »was als etwas Beständiges und Verläßliches dem menschlichen Leben Sinn und Inhalt geben kann«, (13) nach Voraussetzungen also, die die geglückte Erziehung eines Kindes überhaupt erst ermöglichen.
Das wiederum verlangte die »Überwindung des Existenzialismus«. Vor allem pädagogisch boten dessen Zentralkategorien wie »Angst«, »Ekel«, »Langeweile«, »Geworfenheit«, »Verzweiflung« keinen tragfähigen Grund, sie sind in Bollnows Augen Überschüsse der »irrationalen Bewegung« oder der »deutschen Bewegung«, wie sie Herman Nohl, sein akademischer Lehrer, in dem von Bollnow posthum herausgegeben Hauptwerk (14) ausgiebig und im Sinne Diltheys nacherlebbar analysiert und dabei den Zusammenhang mit der pädagogischen Reformbewegung belegt.
»Irrational« meint dabei nicht das Unsinnige, sondern das Überschießende, Überbordende, Übertriebene, wie es im Sturm und Drang und in der Romantik Mode war. An solchen Stellen wird auch Bollnows ausgleichender Habitus greifbar, der sich in dieser Hinsicht der Aristotelischen Ethik verpflichtet sah und von der Analyse der Extreme – hier: Existenzphilosophie – über die Überwindung – hier: »Geborgenheit« – zum Fruchtbarmachen – etwa in der Pädagogik – strebte.
So wollte er der Verabsolutierung und der »Übersteigerung« der existenzphilosophischen Kategorien »Entscheidung«, »Einsatz«, »Entschlossenheit« Gegentugenden wie »Gelassenheit«, »Bereitschaft«, »getroster Mut«, »Geduld«, »Dankbarkeit« und »Hoffnung« entgegenstellen sowie erkenntnistheoretische und ethische Grundlagen für ihre pädagogische Implementierung schaffen. Die ontologische Frage nach der Geborgenheit erkundet etwa die tragende Weltverfaßtheit; die ethische fragt hingegen nach der inneren menschlichen Verfassung und der »sittlichen Anstrengung«, die den Menschen dazu befähigen.
Bollnows Ethik buchstabiert sich maßgeblich in einer praktischen Tugendlehre aus, die man mit der Josef Piepers vergleichen kann, doch mit einem wesentlichen Unterschied. Auch wenn der Begriff der »Gnade« darin eine zentrale Rolle spielt, vermeidet es der Philosoph mit Akribie, das theologische Feld zu betreten. Tugenden müssen – wie alle Fähigkeiten, alles Können – lebenslang eingeübt werden, ja »es gilt zu erkennen, daß die Übung, von den ersten Tagen der Kindheit bis hinein ins höchste Alter, wesensmäßig und lebenslang in einer Weise zum Menschen gehört, daß er nur in beständiger Übung sein eigenstes Wesen erfüllen kann.« (15)
Ansonsten werden die Tugenden – oft im Grenzbereich zu den Gefühlen – in zahlreichen Büchern immer wieder umkreist und neu gedacht; das beginnt bereits unmittelbar nach dem Krieg mit Einfache Sittlichkeit (1947) und Die Ehrfurcht (1947), setzt sich über die Neue Geborgenheit (1955) fort und gipfelt in Wesen und Wandel der Tugenden (1958). Dabei wiederholt er vier methodische Herangehensweisen: Er setzt entweder etymologisch ein oder befragt den allgemeinen, unbefangenen Sprachgebrauch oder stellt die zu untersuchenden Begriffe in Konstellation und Abgleichung zu ähnlichen, naheliegenden Kategorien oder nimmt ein Dichterwort zum Denkanlaß, denn »was bleibet, stiften die Dichter«. Die Tugendlehren sind Fundgruben des Ewiggeltenden, Bewahrenswerten und Idealen in seinen Veränderungen.
Die wesentlichen Arbeiten im ontologischen Bereich widmen sich der Zeit / Geschichtlichkeit und dem Raum. Gerade in der Epoche schwindender und beschleunigender Zeit wird ihm die Erziehung zum richtigen Zeitverhältnis, (16) als subjektiv erlebte Zeit, essentiell. Auch sein Raumverständnis ist relativistisch und wird vom Menschen, von den Objekten, den Handlungen und den Bezügen permanent neu konstituiert. Dem Haus als »Mitte der Welt«, als Ort der Geborgenheit kommt dabei besondere Bedeutung zu. In seinem vermutlich bekanntesten Werk, Mensch und Raum, (17) das noch immer an einigen Hochschulen auf dem Kanon steht, finden sich unter anderem großartige Gedanken über Bedeutung und Funktion des Wohnens, des Wanderns und selbst des Bettes. Dieses Buch ist hervorragend für den Einstieg in Bollnows Denken geeignet.
In seinem Spätwerk wandte sich Bollnow einem weiteren Themengebiet zu: der Sprache. Erneut reichen die Wurzeln weit zurück: Bollnow war mit dem Sprachphilosophen Hans Lipps, 1941 gefallen, befreundet und tat viel dafür, dessen wenig beachtetes Werk immer wieder in Erinnerung zu rufen. Insbesondere in Sprache und Erziehung (18) sinnt er, ausgehend von einer konstatierten »Sprachfeindschaft der Pädagogik«, den ethischen und ontologischen Dimensionen des Sprechens, des Gespräches und des Wortes nach und endet – wie in fast allen seinen Arbeiten – mit pädagogischen Forderungen. Denn das ist das konstitutive Bindeglied, das Ziel seines gesamten Denkens in der hier dargestellten Fülle: die Erziehbarkeit des Menschen. Ein Viertel seines Œuvre widmet sich dieser Frage konkret, der Rest indirekt.
Ein letztes Mal setzt Bollnow mit der produktiven Differenz zur Existenzphilosophie ein, »nach der im Menschen jede Stetigkeit und allmähliche Vervollkommnung ausgeschlossen ist« (19) und sich keine Türen in die Pädagogik öffnen, aber just darin sieht er das Potential, denn die klassischen Erziehungslehren irren gerade im Glauben an eine Kontinuität. Entwicklungen sind sprunghaft von der Geburt bis zum Tod; der Erziehungsbegriff wird auf die Gesamtheit des menschlichen Lebens ausgedehnt. Die Diskontinuität spiegelt sich auch in Bollnows Werk – wenn man die Draufsicht wagt – wider, denn er lehnte die strenge Systematisierung ab, bestand auf der »Unmöglichkeit eines archimedischen Punktes in der Erkenntnis«, nahm jedes zu erhellende Phänomen aufs neue und mit verschiedenem hermeneutischen Besteck oszillierend in Angriff, weshalb es irrigerweise als fragmentarisch erscheinen kann.
In der Anthropologischen Pädagogik – das meint den Titel und das Konzept – laufen jedoch alle Denkstränge und Lebensthemen Bollnows zusammen: Existenzphilosophie, Lebensphilosophie, Tugendlehre, Übung, Stimmungen, Raum, Zeit, Sprache sowie Erkenntnistheorie (20) und die nur fragmentarisch ausgearbeitete Hermeneutik, (21) die hier aus Platzgründen ausgespart wurden.
In ihr wird die anthropologische Betrachtungsweise in der Pädagogik begründet, deren Gewinn weniger konkrete Handlungsweisen sind, aber das »erzieherische Tun in einem allgemeinen Sinn zum Bewußtsein seiner selbst« (22) erhebt und dadurch neue Handlungsräume erschließt. Des Menschen Erziehbarkeit wird dreifach vorausgesetzt: als Erzogener, Erziehender und der Erziehung Bedürftiger, lebenslang und intergenerational, beim gesunden Kind auch als erziehungswilligem und erziehungsfreudigem.
Gehlens Frage nach dem Mängelwesen – der hilflose, unangepaßte Mensch – wird im Sinne des Ausdruckgedankens Diltheys umgekehrt in die Frage nach dem Vorzug der Erziehungsbedürftigkeit. In den Blick gerät die »pädagogische Atmosphäre«. Darunter versteht Bollnow »das Ganze der gefühlsmäßigen Bedingungen und menschlichen Haltungen, die zwischen dem Erzieher und dem Kind bestehen«. (23) Die Geborgenheit bekommt eine neue Facette als der »schützende Umkreis des Hauses und der Familie«. (24)
Insbesondere der Mutter fällt die Aufgabe zu, das Unbekannte ins Vertraute zu holen; ihre Emanationen sind »freudige Gestimmtheit«, »Offenheit«, »Weltvertrauen«, »Gleichgewicht«, »Hoffnung«. Voraussetzung ist der »pädagogische Bezug« Nohls, die liebende Zuwendung des Erziehers. Jedoch beschreibt Bollnow keine Idylle, denn das Leben kennt das Auf und Ab, Rückschritte, Stagnationen, traumatische Einschnitte, und die Pädagogik muß mit »unstetigen Formen der Erziehung« reagieren. Diese werden als »Krise«, »Erweckung«, »Ermahnung« und »Begegnung« klassifiziert, auf die das Kind vorbereitend hinzuführen und zu begleiten sei, auch wenn Art und Zeit unverfügbar bleiben.
An diesen Ereignissen wird sichtbar, daß auch das Leben sich nach hermeneutischen Gesetzmäßigkeiten organisiert: Es gehört zum Wesen des Menschen, »nicht im direkten, vorwärtsschreitenden Gang, sondern immer nur im rückläufigen Verfahren, in der kritischen Auseinandersetzung mit einem entarteten Dasein zu einem unverfälschten reinen Wesen vordringen zu können.« (25)
Die Voraussetzungen einer geglückten Erziehung entwickelt Bollnow dann in seinem hellsten Buch: Die pädagogische Atmosphäre, das auch heute noch zum Kanon einer nicht-»entarteten« erzieherischen Ausbildung gehören sollte. Daß Bollnow konträr zum heutigen Zeitgeist steht, erklärt wohl sein Verschwinden aus dem philosophischen und dem pädagogischen Diskurs – und genau deshalb sollte man ihn wieder lesen und diskutieren.
– – –
(1) – Heinrich Roth: Pädagogische Anthropologie. Band 1: Bildsamkeit und Bestimmung. Band 2: Entwicklung und Erziehung, Hannover 1966 ff.
(2) – Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Gesammelte Schriften VII, Leipzig 1927, S. 146 ff.
(3) – Vgl. Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie, Leipzig 1936.
(4) – Das Wesen der Stimmungen, Frankfurt a. M. 1941.
(5) – Vgl. Die Pädagogik der deutschen Romantik. Von Arndt bis Fröbel, Stuttgart 1952.
(6) – Etwa in: Existenzphilosophie, Stuttgart 1955.
(7) – Vgl. Französischer Existentialismus, Stuttgart 1965.
(8) – Dazu: Michael Landmann: Philosophische Anthropologie, Berlin / New York 1982, S. 41 ff.
(9) – Die Lebensphilosophie, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1958, S. 2.
(10) – Ebd., S. 139.
(11) – Theodor W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie, Frankfurt a. M. 1964.
(12) – Hans-Peter Göbbeler, Hans-Ulrich Lessing (Hrsg.): O. F. Bollnow im Gespräch, Freiburg i. Br. / München 1983, S. 33.
(13) – Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus, Stuttgart 1955, S. 18.
(14) – Vgl. Herman Nohl: Die Deutsche Bewegung. Vorlesungen und Aufsätze zur Geistesgeschichte von 1770 – 1830, Göttingen 1970.
(15) – Vom Geist des Übens. Eine Rückbesinnung auf elementare didaktische Erfahrungen, Freiburg i. Br. 1978, S. 16.
(16) – Vgl. Das Verhältnis zur Zeit. Ein Beitrag zur pädagogischen Anthropologie, Heidelberg 1972.
(17) – Mensch und Raum, Stuttgart 1963.
(18) – Sprache und Erziehung, Stuttgart 1966.
(19) – Existenzphilosophie und Pädagogik, Stuttgart 1959, S. 70.
(20) – Vgl. Philosophie der Erkenntnis. Das Vorverständnis und die Erfahrung des Neuen, und: Das Doppelgesicht der Wahrheit. Philosophie der Erkenntnis, Stuttgart 1970 / 75.
(21) – Studien zur Hermeneutik. Band I: Zur Philosophie der Geisteswissenschaften. Band II: Zur hermeneutischen Logik von Georg Misch und Hans Lipps, Freiburg i. Br. 1982 / 83.
(22) – Anthropologische Pädagogik (1971), in: Schriften, Bd. 7, Würzburg 2013, S. 114.
(23) – Die pädagogische Atmosphäre. Untersuchung über die gefühlsmäßigen zwischenmenschlichen Voraussetzungen der Erziehung (1968), Essen 2001, S. 11.
(24) – Anthropologische Pädagogik, S. 39.
(25) – Ebd., S. 62.