Die Verheißung lebendigen Mitgestaltens in der Demokratie, ihre angeblich so vielfältigen Möglichkeiten, sich aktiv einbringen, Entscheidungen beeinflussen und deren Folgen gestalten, sogar revidieren zu können, das alles hat sich für mich absolut nicht erfüllt.
Nicht daß ich träge und passiv gewesen wäre. Nein, ich war zum einen engagiert berufstätig und habe zum anderen in der politischen Publizistik markante Notizen hinterlassen. Obwohl meine Veröffentlichungen randständig erfolgten, hat es ihnen nicht an Resonanz, namentlicher exekutiver, gefehlt. Ergebnis meines Mich-Einbringens war ein praktiziertes Berufsverbot.
Es geht nicht um Klage oder Enttäuschung, sondern allein um das beredte Beispiel: Kritik, als Beitrag zum freien Diskurs kultiviert vorgebracht, führt hierzulande spätestens seit den Zehnerjahren zu enormen Schwierigkeiten. Wenn man für andere zu sorgen hat und eben nicht als solitärer Abenteurer unterwegs ist, kann man sie sich gegenüber der Herrschaft schon aus privaten Verantwortungsgründen gar nicht leisten.
Meine weit umfassendere Erfahrung besteht aber darin, daß politisch generell kein Heil zu erhoffen oder zu erringen ist – weder von jenen, die einem in die Richtung passen, noch überhaupt. Wer in der Politik gar seine Lebensaufgabe zu finden meint, der wird weitgehend sein geistiges Leben verlieren, wenn er denn je eines hatte.
Keine Frage, Politik ist notwendig, um die öffentlichen Angelegenheiten, die res publicae, zu verwalten – so, daß es weitergeht, günstigenfalls gut. Das ist viel, das ist wichtig, aber es ist das Eigentliche nicht, jedenfalls nicht das, woraus der Mensch lebt.
Und phänomenal, daß die Führung des Politischen kaum jene übernehmen, denen man wirklich trauen wollte – nicht allein, weil die Machtorientierten offensiver sind, sondern weil es nicht nur die Guten und Charakterstarken, sondern nicht weniger die Nachdenklichen und Stilleren oben an Entscheidungsstellen der Macht gar nicht aushalten würden. Allein das Milieu dort ließe sie verkümmern.
Jahrelange Tätigkeit in der Nähe der „Herzkammer der Demokratie“, also der Legislative, offenbarten mir als Beobachter des einerseits von öder Behäbigkeit, andererseits von billiger Polemik bestimmten Schauspiels nicht nur die Vergeblichkeit echten Bemühens innerhalb der parlamentarischen Farce, sondern vielmehr die Tragikomik, daß politisch nichts Eigentliches zu bewegen ist, sondern darin lediglich Kräfte mit ihren jeweiligen Primitivbedürfnissen jongliert werden. Der jüngste Merzsche Wahlbetrug gibt dem auf eindrucksvolle Weise Ausdruck.
Wie gesagt: Das alles mag so notwendig wie nicht anders zu haben sein, nur ist das kein hinreichender Grund, sich damit selbst identifizieren zu müssen.
Ohne daß ich Karriere machte noch diese je auch nur anstrebte: Weiter als ich kam, konnte ich gar nicht kommen – nämlich bis zum Ende einer Illusion. Das verbittert nicht, sondern befreit.
Ich sah aus nächster Nähe, wie sich Herrschaft ausformt und ausgestaltet, ich sah ihre Protagonisten und deren narzißtisch bedingte Protz-Symbolik – von den albernen spitzen Schuhen bis zu den dicken Karren, ohne die sich Herrschaft nicht bewegen läßt.
Am Ende war mir aus durchaus ethischen Gründen prinzipiell jeder verdächtig, der auch nur ein Sakko trug. Das obligatorische weiße Hemd, gebügelt bis gestärkt, soll vor allem davon künden, daß man von Arbeit unbefleckt wäre und es geschafft hätte, keinerlei Güter produzieren oder Dienstleistungen verrichten zu müssen.
Aufrichtig konnte ich nur noch den Handwerkern, Technikern und Reinigungskräften gegenüber sein. Sie empfand ich als ehrenwert, handelten sie doch eigenverantwortlich und sorgten auf so unauffällige wie redliche Weise für ihre Existenz. Daß die „Volksvertreter“ selbstgefällig von den Abgaben dieser vermeintlich „kleinen Leute“ lebten, schien allerdings den einen wie den anderen kaum bewußt.
Die den Betrieb am Laufen halten sind im Gegensatz zu Politikern und „Mandatsträgern“ nicht nur weitgehend machtlos, sondern entbehren der Anerkennung und Wertschätzung. Nirgendwo ist der Kontrast augenfälliger als in Herrschaftsgebäuden, wo die Putzfrau der Ministerpräsidentin begegnet und der Chauffeur den Staatssekretär zu kutschieren hat.
Was für ein bitterer Witz doch, daß die einen sich anmaßen, für die anderen zu sprechen und über deren Geschicke zu entscheiden, weil sie meinen, die hätten sie dazu ja in einem Wahlakt legitimiert. Ein billig nettes Wort, für das mit servilem Lächeln zu danken ist, zeigt eher, daß sich zwischen Herrschern und Beherrschten nichts geändert hat. Und nie etwas ändern wird.
Die einzige Bedingung der Mandatierten, ins „Hohe Haus“ einzutreten, war mit ihrer Kur auf Listenparteitagen erfüllt; mehr bedurfte es nicht; um so mehr aber bedürfen wiederum die Gekürten der bezahlten Helfer und neben dem komfortablen Rundumservice insbesondere eines Trosses aus Juristen, Bürokraten, Referenten und Schreibern.
Ganz so wie einst: Es gibt nach wie vor die mit der Feder am Hut und jene mit der Feder in der Hand. Es gibt jene, die im Maschinenraum arbeiten, und es gibt die vermeintlich feinen Leute an Deck. Man lese einfach Bertolt Brechts „Fragen eines lesenden Arbeiters“ noch mal neu.
Wie wäre nachzuempfinden, daß Parlamentssitzungen im Wortsinne Arbeit sein sollten und daß Entscheidungen über andere zu fällen sogar Kampf wäre?
Bereits die Überzeugung, andere Menschen, sogar selbständig arbeitende Leistungsträger, als „Volksvertreter“ repräsentieren zu können und für sie sprechen zu dürfen, halte ich für eine dreiste Anmaßung mit Tendenz zur Mißbrauchsbereitschaft.
Wer denn kann tatsächlich eine solche Verantwortung tragen – und tragen wollen? Symptomatisch, daß es im Parlament immer weniger beruflich Selbständige, namentlich immer weniger Unternehmer gibt. Die tragen Verantwortung für sich und ihre Leute, und genau das ist Mühe genug, gerade unter der gegenwärtigen Herrschaft.
Wer solche Verantwortung kennt und sie zu meistern versteht, erdreistet sich nicht noch, sie gegenüber Volk und Nation sowie gar noch für Europa und die Welt wahrzunehmen.
Schwierig bis unmöglich, unter all den aufgeputzten Entscheidungsträgern jemandem zu begegnen, der integer ist und die niederen Chargen sieht oder gar anerkennt. Je höher der Rang, um so unmöglicher, doch noch die Bekanntschaft eines vorbildlichen oder mindestens interessanten Menschen zu machen. Die authentischen Typen laufen im grauen Troß der Bediensteten mit.
Mag gar sein, der Erfolg der AfD erklärt sich aus der so nachvollziehbaren wie instinktiven Ablehnung der einfachen Leute gegenüber der Arroganz des Establishments der Berliner Republik.
Es braucht diesen pauschalen Arbeitsbegriff „einfache Leute“, um irgendwie den Unterschied zum „Bürger“ aufzuzeigen. Der Bürger nämlich ist angepaßt, er profitiert irgendwie von der Macht und ist Teil der Entscheidungsträgerschaft. Der Bürger wohnt jetzt am Prenzlauer Berg, die einfachen Leute eher in Marzahn oder Wittstock.
Es wird allerdings interessant zu erleben sein, ob die AfD tatsächlich in der Lage ist, das System zu verändern, oder ob vielmehr das System – weniger das vermeintlich demokratische als substantiell jenes der Herrschaft – sich nicht eher die AfD anverdaut. Herrschaft korrumpiert immer. Sollte das politikgeschichtlich erstmalig nicht geschehen, wenn die AfD an ihr partizipiert?
Gut, das weiß der Mythos, das wissen die Volksmärchen und Sagen, das ist „im Volk“ tief empfundene Gewißheit:
Herrschaft bedarf der charakterlosen und niveauflexiblen Wendigkeit, ganz praktischerweise sogar der Bereitschaft zu Unmoral und Gewalt; sie ist insofern dem Kriminellen immer verwandt und kriminell besonders effizient. Machiavelli beschrieb trefflich, was bis heute Gültigkeit hat.
Wer jedoch beim Eintritt in den Herrschaftsbereich quasi antizyklisch feste Moralvorstellungen oder einfach nur Herzensbildung mitbringt, einen guten Willen und beste Vorsätze, der wird dies dort zwangsläufig verlieren, ja verlieren müssen – andernfalls scheidet das System ihn als erfolglos aus.
Wer jedoch darin verbleibt, den korrumpiert es, und darin liegt für die allermeisten ja direkt der Grund des Bestrebens, so lange wie möglich in den weichen Sesseln des Parlaments oder hinter den breiten Schreibtischen der Exekutive auszuharren. Um das, was dort zu holen ist, ins eigene Schatzhaus zu schleppen.
Das Schwierigste daran: Es ist schlechterdings überhaupt nicht anders vorstellbar, denn Politik kann als Regie für das Zusammenleben von Menschen, die nun mal Mängelwesen sind, selbst immer nur mangelhaft sein, ganz natürlicherweise.
Es wird also nie irgendwie verbesserte Varianten dafür geben, weil der Mensch, insbesondere der säkularisierte, rational handelnde, nur in diesem System, in solcher Herrschaftsform zu denken ist, in einer Art Geschäft, das meint, gerecht wäre, wofür eine immer neu flott auszurechnende Mehrheit, als Summe von irgendwelchen Fraktionen, steht – quantifiziert, nicht etwa qualifiziert zustande kommend. Die Demokratie ist ein lauter und bisweilen peinlicher Basar; sie folgt simplen utilitaristischen Beweggründen.
Mag hier und da in Kenntnis eben des Mängelwesens Mensch sogar für „checks and balances“ gesorgt sein, so steht diesen Regularien doch viel stärker das latente Grundbedürfnis nach deren Überwindung entgegen, so daß mitunter selbst absolutistische oder diktatorische Herrschaft in ihrer ungeschminkten Machtausübung redlicher erscheinen mag als das inszenierte Prozedere im „Als-ob“ der Demokratie, der in ihrem verbrämten Machtkampf das fehlt, was autoritäre Herrschaften offen hervorbringen oder was sie gar bedingt – echtes Charisma als direkter, als ungeschminkter, gar propagandistisch zur Schau getragener Ausdruck der Macht, also gewissermaßen echt shakespearesches Format im Risiko, tragisch. verdammt und verloren zu enden. Letzteres hat ja unwillkürlich noch Größe, wenngleich zwar auf Kosten vieler Opfer.
Selbst Mafia-Paten verfügen mindestens in Antlitz, Ästhetik und Haltung über einen Reiz, den solche Operettendienstgrade wie Ausschuß- und Fraktionsvorsitzende, Abteilungs- und Referatsleiter aus Gründen fehlenden Formats nicht mal physiognomisch entwickeln können.
Die Demokratie als Massenverwaltung nivelliert ihre Adepten zu modernen Hofschranzen, die selbst allerdings glauben wollen, daß das, was sie so zu besorgen haben, gut und gerecht wäre.
Erlebt man das Schauspiel, analytisch angeschaut oder auch nur intuitiv empfunden, dann drängt es einen mit gesundem Reflex hinaus. Wobei eine politische Alternative allerdings immer nur wieder eine veränderte, aber neuerliche Farce wäre.
Es läuft nicht anders als so wie bisher und immerfort. Aber daß es nicht anders zu denken ist, heißt eben nicht, daß es deswegen gleichsam gut oder nur erträglich wäre. Man finde sich also entweder mit der Alternativlosigkeit des Demokratischen als werbewirksames Gewand der Herrschaft ab und verlassen sich auf die stets brüchige Rechtsstaatlichkeit oder suche einen Weg des Verzichts auf dieses politische Spiel.
Insofern man selbst nichts ausrichten kann, überlasse man den anderen das Feld.
– – –
II. Wo aber läge die Alternative?
Straffster Existentialismus, zunächst im therapeutischen Minimum der Maßgabe „Bleib bei dir!“ Kleide vor allem deine eigenen narzißtischen Anteile nie in Macht; dafür stehen genügend andere nur allzu gern bereit.
Zudem ist stille Verachtung die einfachste, aber konsequenteste Form des Widerstands. Sie hilft sogar im Sinne Albert Camus: „Es gibt kein Schicksal, das nicht mit Verachtung überwunden werden kann.“ Oder etwas weniger pathetisch: Umkehr ist immer Abkehr.
Apropos Philosophie, apropos Existentialismus – im Sinne eines möglichen Modells: Bestechend das, was Sören Kierkegaard (1813 – 1855) anbietet, und zwar radikal konsequent mit dem „Sprung“, und zwar dem Sprung in den christlichen Glauben. Das irritiert zunächst.
Springen ist riskant, zumal ins Unbekannte, Ungewisse hinein; ein Sprung ereignet sich nicht, widerfährt einem nicht; man muß ihn wagen, im Kierkegaardschen Sinne völlig rückhaltlos, ganz so wie vom Zehnmeterbrett, allerdings sogar derart gesteigert, als wüßte man oben gar nicht nicht, ob das Wasser unten tief genug ist.
Ohne Versicherungen also volles Risiko, und dies zudem als ganz einsame Angelegenheit, für die man seine Verantwortung nicht wegdelegieren kann. Bleibt die Hoffnung – zum einen, daß man überlebt, zum anderen, daß man aus bisherigen Zwangsvereinnahmungen und mehr noch aus einem falschen Leben befreit wird.
Kierkegaard sehnte sich danach, ganz wahrhaft Mensch zu sein, erreichte dies jedoch weder ästhetisch orientiert, also als romantisierender Bohemien, noch als in Pflichtethik erstarrter Bürger. Über einen Einstieg in die Politik dürfte er nie nachgedacht haben, sondern sah nur den einen konsequenten, allerdings in konventioneller Ansicht geradezu wahnwitzig anmutenden Ausweg – eben abzuspringen, in die Religion des Christentums, die bereits zu seiner Zeit immer mehr Menschen als unsicheres Terrain, gar als Nonsens galt, trotz oder gerade wegen der Heils- und Leidensbotschaft Christi.
Daß dieser Übergang im totalen Risiko nicht mit einem ruhigen Hinüberwachsen zu bewerkstelligen war, etwa im Sinne einer sich rückversichernden theologischen Qualifizierung, sondern daß es des einen konsequenten Schrittes ins Unsichere bedurfte, eines Sprunges eben, wußte übrigens auch Gotthold Ephraim Lessing, verzichtete selbst aber, verkürzt formuliert, eben aus Vernunftgründen.
Wer tritt schon aus dem geistesgeschichtlich gerade erst errungenen Vernunftbegriffen und damit aus dem Sicherheit verheißenden Rationalismus heraus ins völlig Ungewisse wie in einen dunklen Wasserspiegel überm Abgrund der Tiefe, in der irren Hoffnung, dort wären unter der blickdichten Oberfläche doch Halt und Sicherheit?
Der Sprung als „Wagestück des Herzens, in dem ein Mensch sich hinauswagt und alle Klugheit, und alle Wahrscheinlichkeit aus den Augen verliert.“ Kein Kalkül mehr, sondern das so riskante wie befreiende Ablegen vom sicheren Ufer, hinter sich die die entschwindende Küste – vor sich nicht mal ein terra incognita, sondern das unendlich Unwägbare.
Anders läßt sich Gott nicht entdecken. Übersprungen wird der eigene Verstand ebenso wie der bisherige bürgerliche Lebensentwurf. Kierkegaard notiert: „Der Glaube ist darum, was die Griechen den göttlichen Wahnwitz nennen.“
Das Hohnlachen gegenüber diesem Ziel muß man im einundzwanzigsten Jahrhundert noch mehr als im neunzehnten aushalten können: Christlicher Glaube? Was soll das denn!? Zumal heute in der Kirche gleichfalls vor allem auf Politik und Ideologie trifft. In einem schon beinahe wagemutigen Essay vertrat Hannah Bethke kürzlich daher die Auffassung, die Kirchen müßten gerade hierzulande zurückfinden zu einer echten Sprache des Glaubens.
Was bleibt? Konsequenter und mit mehr Einsatz selbst entschieden sein, im Mut zum Ungewissen, im Aushalten des Unwahrscheinlichen, wobei schon gar nicht auf die Titularchristen-Bürokratie zu hoffen oder auf sie gar Rücksicht zu nehmen ist. Christlicher Glaube dürfte ja, wiederum politisch verursacht, mit christlicher Kirche immer weniger zu tun haben.
Das Existentialistische daran: Ich bin allein auf mich selbst gestellt, niemand kann mich, aber gleichfalls niemand muß mich zum Sprung „legitimieren“, ebensowenig wie mich jemand auffangen kann, wenn ich es wage, gegen alle gängigen Formeln konsequent aus dem Unverfügbaren zu leben, weil mir das Verfügbare zum Leben nicht ausreicht.
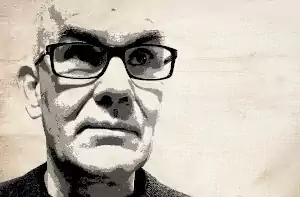
Rudolf Kayser
Brechts doppelt faule Volksromantik als leiser werdendes Echo gegen die Radikalvergewisserung Kierkegaards? Interessanter Gedanke. Unsichtbare Kirchen oder "Politik der Seele"? Das einfache Volk wird heute zwar unterschätzt, dann unterdrückt, dann eingedämmt, letztlich auch gefürchtet als eine jederzeit drohende Sintflut des Wirklichen gegen die Kulissen der Illusionen, Symbole und Imaginationen ‐ andererseits bezieht das einfache Volk die potentielle Kraft seiner Flut nur aus seinem blinden nichtreflektierten Zustand.