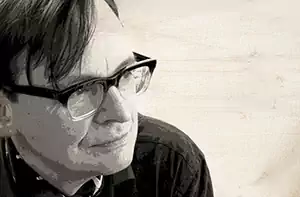Im Hinblick auf die anstehenden 58. US-Präsidentschaftswahlen im November dieses Jahres steht, was die aussichtsreichen Kandidaten Hillary Clinton (Demokraten) und Donald Trump (Republikaner) angeht, auch die Frage nach einem Richtungswechsel in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten im Raum. Während im Fall Clinton, 2009 bis 2013 Außenministerin der Regierung Obama, davon ausgegangen wird, daß sie im Fall ihrer Wahl zur ersten Präsidentin der USA grosso modo den »multilateralen« Kurs des jetzigen Amtsinhabers fortführen wird, sieht es im Fall einer Wahl des »Immobilien-Tycoons« Donald Trump anders aus.
Für diese Einschätzung gibt es gute Gründe: Trump hat, so zum Beispiel bei einer Grundsatzrede Ende April in Washington, unmißverständlich klar- gemacht, daß er die Außenpolitik der USA seit Ende des Kalten Krieges für ein »Desaster« hält, für eine Folge von strategischen Fehlern, die letzt- lich zu einer Schwächung der USA und zu einer Stärkung ihrer Gegner geführt habe.
Um außenpolitisch und militärisch wieder stark zu werden, bedarf es aus der Sicht Trumps einer wirtschaftlichen Regeneration. Im Vordergrund aller Bemühungen müsse die Maxime »America first« stehen, was Trump-Kritiker als Bekenntnis zu einer unilateralen Außenpolitik deuten. Damit stehen mit Blick auf Clinton und Trump die Alternativen im Raum: Unilateralismus, ja Isolationismus, wie ihn zum Beispiel Marcus Pindur im Deutschlandfunk bei Trump orten zu können glaubt, versus Multilateralismus, der in der Regel Hillary Clinton zugeschrieben wird.
Ob und inwiefern es sich hier um tatsächliche Alternativen oder nicht vielmehr um verschiedene Etiketten handelt, unter denen die Vereinigten Staaten eine Interessenpolitik verfolgen, die im Kern von einer eisernen Konstante geleitet wird, nämlich der Bewahrung der dominanten Rolle der USA im internationalen Staatensystem, der sich weder Trump noch Clinton verschließen können, soll im folgenden anhand von zehn Thesen zur US-Außenpolitik beantwortet werden. Der Bogen wird dabei von kulturell bedingten Besonderheiten der US-Außenpolitik (»Einzigartigkeit« der USA) über die wichtigsten Denkschulen zu den (verdeckten) außen- politischen Weichenstellungen der Regierung Obama bis hin zu den einschlägigen Vorstellungen des republikanischen Kandidaten und der demokratischen Kandidatin geschlagen.
1.) Die Idee eines »amerikanischen Exzeptionalismus« ist ein wesentli- cher kultureller Pfeiler im Selbstverständnis der US-Außen- und Sicherheitspolitik.
Ein bedeutender Faktor der US-Außen- und Sicherheitspolitik ist die Ideologie der amerikanischen Einzigartigkeit (American exceptionalism), die ihre Wurzeln in der Kolonialgeschichte der Vereinigten Staaten hat. Europa wird von dieser Warte als Ägypten wahrgenommen, das das wandernde Gottesvolk verlassen hat, Amerika hingegen als das »gelobte Land«, als das »Neue Jerusalem«.
Dem »Neuen Jerusalem« indes, das alles überstrahlt, stehen »Orte des Schmutzes«, »Schurkenstaaten« gegenüber, gegenüber denen es keine Kompromisse geben kann. Auseinandersetzungen mit diesen »Schurkenstaaten« (»Feinde der Menschheit«) werden deshalb häufig in manichäischer Weise als Kämpfe zwischen Gut und Böse inszeniert. Es waren vorrangig demokratische Präsidenten wie Wilson, F. D. Roosevelt, Truman, Kennedy und auch Bill Clinton – von dem durch »Neocons« beeinflußten Republikaner George W. Bush einmal abgesehen –, die sich dieses Manichäismus bedient haben. Es liegt in der Natur der Sache, daß dieser Exzeptionalismus Auswirkungen auf die Außenpolitik hat; zum Beispiel in der impliziten Erwartungshaltung, daß der Rest der Welt das amerikanische Modell »nachempfindet«.
2.) Die Vereinigten Staaten sehen eine »offensichtliche Bestimmung« (Manifest destiny) zur Expansion.
Die Vorstellung, daß es für die USA so etwas wie ein Manifest destiny (»offensichtliche Bestimmung«) gebe, steht im engen Zusammenhang mit der Idee der amerikanischen Einzigartigkeit. Die USA hätten einen göttlichen Auftrag zur Expansion, der sich zunächst auf die Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende westliche Grenze in Richtung Pazifik bezog. Es sei»die offenkundige Bestimmung der Nation, sich auszubreiten und den gesamten Kontinent in Besitz zu nehmen, den die Vorsehung uns für die Entwicklung des großen Experimentes Freiheit und zu einem Bündnis vereinigter Souveräne anvertraut hat« (John L. O’Sullivan). In dieser auf dem Exzeptionalismus fußenden Doktrin manifestiert sich ein übergreifendes Sendungs- und Missionsbewußtsein, das auch die US-Außenpolitik durchdringt.
3.) Der Weg von der Monroe-Doktrin (1823) zum Pan-Interventio- nismus war folgerichtig und manifestierte die Rolle der USA als eines »Richters der ganzen Erde«.
Die Monroe-Doktrin fußt auf einer Rede zur Lage der Nation vom 2.Dezember 1823, in der US-Präsident James Monroe vor dem Kongreß die Grundzüge einer langfristigen Außenpolitik der Vereinigten Staaten entwarf. Monroe formulierte die Existenz zweier politischer Sphären, für die er mit Blick auf Europa ein gegenseitiges Interventionsverbot für raumfremde Mächte forderte. Die Vereinigten Staaten verzichteten damit auf jegliche politische und militärische Einmischung in Europa. Sollte aber ein anderer (europäischer) Staat Kolonialansprüche haben, die auf Gebiete des Doppelkontinents Amerika und der umliegenden Inseln abzielten, würden die Vereinigten Staaten dies als feindliche Handlung ansehen.
Anfang der 1930er Jahre wurde diese Doktrin durch die Hoover- Stimson-Doktrin in entscheidender Weise erweitert. Die USA behalten sich dieser Doktrin zufolge für alle Teile der Erde vor, Besitzänderungen, die aus Sicht der Vereinigten Staaten zu Unrecht zustande gekommen sind, die Anerkennung zu verweigern. Was hier »zu Unrecht zustande gekommen sind« konkret bedeutet, bestimmen allein die USA. Mit dieser Doktrin, die sich dann auch Franklin D. Roosevelt zu eigen machte, taten die USA einen entscheidenden Schritt hin zu einer globalen imperialen Macht, sehen sie doch bei jeder Kriegshandlung in irgendeinem Teil der Erde ihre Interessen berührt.
4.) Die Außenpolitik der USA ist im hohen Maße geopolitischen Paradigmen verpflichtet.
Einer der ersten geostrategischen Militärtheoretiker, dessen Werk – in den USA, aber auch in Europa (Stichwort: die Flottenpolitik Alfred von Tirpitz’) – einen nachhaltigen Einfluß entfaltete, war der Marineoffizier Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914). Mahan gab die Empfehlung ab, sich am Britischen Empire auszurichten; dementsprechend sollten die USA darangehen, eine Seemacht aufzubauen. Als entscheidende Faktoren, um den Status einer Seemacht zu erreichen, werden Außenhandelswirtschaft, Handels- und Kriegsmarine sowie Kolonien bzw. Stützpunkte beschrieben. Apodiktisch forderte Mahan: »Ob die Amerikaner wollen oder nicht, nun müssen sie beginnen, über die Grenzen ihres Landes hinaus- zublicken.«
Nach diesem geopolitischen Big bang folgten weitere einflußreiche Arbeiten, von denen hier nur noch eine Arbeit hervorgehoben werden kann, die wohl einen ähnlichen Einfluß wie die von Mahan entfaltet hat und immer noch entfaltet, nämlich Zbigniews Brzezinskis »Handbuch« geopolitischer Imperative The Grand Chessboard (dt. Die einzige Welt- macht, 1997), das der realpolitischen Schule verpflichtet ist. Der historische Kontext des Brzezinski-Buches ist der Zerfall der Sowjetunion und der damit verbundene Aufstieg der Vereinigten Staaten als »erste, einzige, wirkliche und letzte Weltmacht«, die eine Hegemonie neues Typs ausübe, zu der es in der Geschichte keine Parallele gebe. Ziel der USA müsse es sein, die Vorherrschaft auf dem »großen Schachbrett« Eurasien zu sichern, um so eine »neue Weltordnung« nach ihren Vorstellungen abzusichern.
5.) Die multilaterale und die realistische Denkschule sind verschiedene Ansätze, die im Kern ein Ziel verfolgen, nämlich die internationale Führungsrolle der USA sicherzustellen.
Zwischen den »liberalen« (multilaterale Denkschule) und den klassischen »konservativen Internationalisten« (realistische Denkschule) ist unstrittig, daß den USA die Führungsrolle im internationalen System zukommt. Die »konservativen Internationalisten« – Beispiele hierfür wären Henry Kissinger, Samuel Huntington oder Zbigniew Brzezinski – gehen davon aus, daß das internationale System »anarchisch« sei und sich die Staaten in einem permanenten Konkurrenzkampf befänden. Deshalb könnten keine dauerhaften supranationalen Machtstrukturen ausgebildet werden. Das vorrangige Staatsziel müsse deshalb die Sicherung des eigenen Staates sein, was vorrangig durch die Akkumulation von Macht (z. B. Wirtschaftskraft und militärischer Stärke) zu gewährleisten sei. Deshalb strebten alle Staaten nach Macht; mit dem Ziel, mehr Macht als andere Staaten zu erlangen.
Demgegenüber vertreten die »liberalen Internationalisten« die Auffassung, daß multilaterale Mechanismen anderen Staaten die Chance eröffneten, ihre Interessen und Perspektiven einzubringen, was die Akzeptanz der Führungsrolle der USA erhöhe. Diese werde weiterhin durch die Bereitstellung »öffentlicher Güter« (wie der Sicherung internationaler Handelswege) erhöht, von denen auch andere Staaten profitierten. Schließlich optiert die multilaterale Denkschule für die Aufrechterhaltung kooperativer Beziehungen mit Großmächten, womit verhindert werden soll, daß diese die von den USA geprägte internationale Ordnung herausfordern.
6.) Die Vereinigten Staaten sehen sich als Garant internationaler Stabilität und als »unverzichtbare« Ordnungsmacht.
Strittig zwischen beiden Denkschulen ist der vorrangige Modus des internationalen Engagements, »das Mischungsverhältnis von Multilateralismus und Unilateralismus«, wie es Peter Rudolf (SWP Berlin) genannt hat, der auch deutlich macht, daß die Außenpolitik der USA nach 1945 zunächst stark von der Idee einer multilateralen Ordnung geleitet war, sprich vom Aufbau supranationaler Institutionen, deren Regeln für alle gelten sollten, womit sich die amerikanische Hegemonie von allen sonstigen Formen hegemonialer Machtausübung unterschied. Nach amerikanischer Auffassung ist diese Führungsrolle nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch in dem der meisten anderen Staaten, weshalb mit Blick auf die Rolle der Vereinigten Staaten von einem »wohlwollenden Hegemon« gesprochen werden könnte.
Die Haltung der USA gegenüber internationalen Institutionen muß jedoch als ambivalent bezeichnet werden; sie wer- den für die Durchsetzung eigener Interessen genutzt, die Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit wird aber in der Regel abgelehnt.
7.) Die Regierung Obama hat der Kräfteüberforderung (Imperial overstretch) Rechnung getragen und die US-Außenpolitik neu ausgerichtet.
Die außenpolitische Bilanz der Regierung Obama, die im wesentlichen auf einen pragmatischen Multilaterismus unter Einbindung der transatlantischen Netzwerke setzte, ist umstritten; Obama wird vor allem Versagen in der Krisen- und Interventionspolitik vorgeworfen. In der Tat setzte Obama auf Diplomatie und sah die USA nicht in der Rolle des Weltpolizisten, der »Schurkenstaaten« mit dem »großen Knüppel« droht. Die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008, aber auch das Erbe des Pan-Interventionismus der Ära George W. Bushs im Zuge von »9 /11«, der letztlich eine Kräfteüberforderung zur Folge hatte, erforderten eine Neuausrichtung der US-Außenpolitik.
Im Kern verfolgte Obama eine Politik des Offshore balancing, wie es von den Politologen John Mearsheimer und Stephen Walt skizziert worden ist. Dieses Konzept lenkt den Fokus der USA auf drei strategisch wichtige Regionen: Europa, Nord- Ost-Asien (Stichwort: »Pivot to Asia«) und den Persischen Golf. Ziel der US-Außenpolitik müsse es sein, zu verhindern, daß in diesen Regionen ein Land in einer Weise dominiert, wie es im Fall der USA im Hinblick auf Lateinamerika der Fall ist. Dieser Ansatz verzichtet sowohl auf ei- nen massiven Militäreinsatz als auch auf eine zu starke internationale »Sichtbarkeit« der USA.
8.) Die verdeckte Grand strategy Obamas verfolgt das Ziel, aus den USA ein Handelsimperium zu machen.
In seinem energiepolitischen Strategieentwurf vom März 2011 erklärte Obama unter anderem, daß die Vereinigten Staaten »Marktführer in der globalen Energiewirtschaft« werden müßten, was auf eine verstärkte globale Führungsrolle der USA in den nächsten Jahren hinausläuft. Der Fokus der USA liege, so die These einer Studie von Malte Daniljuk, »klar auf der Schaffung eines Handelsimperiums«, das mit dem Britischen Empire vergleichbar sei. Im Rahmen dieser Grand strategy sei der erfolgreiche Abschluß eines Freihandelsabkommens mit der EU (TTIP) ein wichtiger Meilenstein, da in den USA seit Mitte der 1970er Jahre ein Exportverbot für fossile Energieträger besteht, das nur mit Freihandelsabkommen umgangen werden kann. Daß diese Strategie implizit gegen Rußland gerichtet ist und die energiepolitische Abhängigkeit Europas von Rußland zugunsten einer engeren Anbindung an die USA lockern soll, liegt auf der Hand.
9.) Sowohl Donald Trump als auch Hillary Clinton werden an Ob- amas Außenpolitik anknüpfen.
Mit seiner Grand strategy, aber auch mit der Politik des Offshore balancing hat Obama einen Weg aufgezeigt, wie die Überdehnung der Ressourcen, die zu einer wirtschaftlichen und militärischen Schwächung der USA geführt hat, zu überwinden wäre. Trägt diese Strategie Früchte und kommt es zu einer wirtschaftlichen Stärkung der USA, ist ein entscheidender Schritt getan, die USA außenpolitisch, aber auch militärisch wie- der stark zu machen. Alles das kommt Trumps »America-first«-Forderung und seinen außenpolitischen Vorstellungen, die grosso modo den Maximen einer realistischen Außenpolitik verpflichtet sind, entgegen. Das gilt insbesondere für seine Maxime, der Westen solle seine Werte nicht durch militärische Interventionen, sondern auf der Basis seiner wirtschaftlichen Leistung verbreiten. Gleiches gilt für Hillary Clinton, die sich wohl aufgrund ihres Konkurrenten Trump außenpolitisch verbalradikaler als Obama gibt, im Falle ihrer Wahl letztlich aber doch auf dessen außenpolitische Vorgaben einschwenken dürfte.
10.) Auch mit Trump als US-Präsident wird es keine Rückkehr zum Isolationismus geben.
Aus dem oben Gesagten folgt auch, daß es auch unter einem US-Präsidenten Trump keine Rückkehr zu einer isolationistischen oder semi-isolationistischen Politik geben wird, wie das bestimmte Auguren in Deutschland hysterisch an die Wand malen. Auch Trumps Aussagen, mit ihm werde es »keine Abkommen geben«, die »die Fähigkeit der USA«, die »eigenen Angelegenheiten zu kontrollieren, beeinträchtigen« – was als Absage an TTIP gelesen wird –, sind als Wahlkampfgetöse zu relativieren. Es sind nicht nur machtpolitische Gründe, die für derartige Abkommen sprechen, son- dern auch die Interessen des transatlantischen Finanzkapitals, denen sich auch ein Trump nicht verweigern können wird. Nicht ausgeschlossen werden kann indes, daß er gegenüber dem Rußland Wladimir Putins andere Akzente setzt.