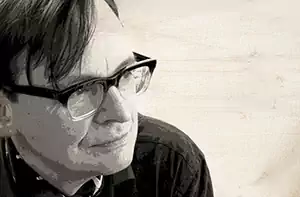In dem Buch Die Amerikanisierungsfalle (2007) der Wirtschaftswissenschaftlerin Ulrike Reisach gibt es ein Kapitel, übertitelt mit »Der Markt als Kriegsschauplatz«, in dem sie sich mit dem »Kulturkampf« in deutschen Unternehmen auseinandersetzt. »Kulturkampf« meint hier die zunehmende Orientierung deutscher Unternehmen an amerikanischen Managementmethoden und das damit verbundene, wie Reisach herausstellt, ständige »einseitige« Schielen auf Aktienkurse und Quartalsergebnisse. Damit im Zusammenhang steht eine starke Erfolgsorientierung, die zwischen und innerhalb von Unternehmen zum Konkurrenzkampf führe, »bei dem es um das Überleben am Markt« gehe.
Die Amerikaner pflegten in diesem Zusammenhang ganz bewußt »kriegerische Analogien«, Bücher über Kriegskunst, wie die von Clausewitz oder Sun Tzu, erfreuten sich deshalb »großer Beliebtheit«. Der »Sieg und der unbedingte Willen zum Sieg« würden zu Antriebsfedern und auch zum Auswahlkriterium für Führungskräfte.
Auf dem »Kriegsschauplatz Markt« macht nun seit einiger Zeit ein neues Schlagwort die Runde, das mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist und den Kanon martialischer US-Managementrhetorik um einen neuen, bezeichnenden Begriff erweitert. Gemeint ist das Schlagwort »Disruption«, 2015 bereits »Wirtschaftswort des Jahres«, das auf gut deutsch »zerreißen« oder »unterbrechen« bedeutet. Auf dem Weltwirtschafsforum in Davos im Jahre 2016 war »Disruption« eines der dominierenden Themen; dort kam man zu der Überzeugung, daß die »digitale Disruption« gerade erst begonnen habe. Angesichts der Omnipräsenz dieses Begriffes spöttelte sogar die sonst so wirtschaftsliberale FAZ: »›Disruption‹ ist immer und überall, alles und jedes wird ›disrupted‹, sogar der Tante-Emma-Laden um die Ecke, der sich eine App bastelt, kommt sich mächtig progressiv vor. Disruptiv halt.«
Was nun aber bezeichnet »Disruption« eigentlich genau? Der Begriff beschreibt einen Prozeß, der in erster Linie mit den Umbrüchen der Digitalwirtschaft in Zusammenhang gebracht wird: Bestehende, traditionelle Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien oder Dienstleistungen werden immer wieder von innovativen Erneuerungen abgelöst oder teilweise vollständig verdrängt. Anschaulich werden die hier gemeinten Vorgänge zum Beispiel anhand des Aufkommens online gestützter Musikvertriebe (z. B. iTunes), die sukzessiv zur Zerschlagung des lokalen Musikgeschäftes geführt haben.
Diese Musikvertriebe geben dem Kunden einerseits die Option, Musik beliebig herunterzuladen, während Musikern andererseits die Möglichkeit eröffnet wird, auch ohne ein Musiklabel erfolgreich zu sein. Für Musikhändler und Preßwerke hingegen bedeutet diese Entwicklung, daß ihnen, reagieren sie nicht selbst mit individuellen innovativen Modellen, mehr und mehr der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Was heute für den Besitzer von Musik-CD-Läden gilt, gilt morgen womöglich für alle möglichen Wirtschaftsbereiche: Wer sich nicht auf die Logik der digitalen Märkte ausrichtet und als »Effizienzbremse« erweist (so der Journalist Christoph Keese, der den Herold der »disruptiven« Botschaft von Silicon Valley in Deutschland gibt), wird, egal wie etabliert das Unternehmen war und wie lang die Unternehmensgeschichte ist, auf dem »Kriegsschauplatz Markt« zerstört und verschwindet; genau das meint »Disruption« im Kern.
Kodak, der vom Markt gefegte Hersteller für photographische Ausrüstung, gilt als Paradebeispiel dafür, was je- nen passiert, die nicht »disrupten«: In seinen besten Zeiten hatte Kodak 150000 Mitarbeiter, 2012 war der einstige Gigant insolvent, weil er die digitale Revolution verschlafen hatte.
US-Netz-Giganten wie Google, Apple, Microsoft, Oracle oder auch Amazon – oft im kalifornischen Silicon Valley beheimatet –, gelten als Inbegriffe für »Disruption«. Gemäß dem »Trend- und Zukunftsforscher« Matthias Horx wirkten sie nicht nur durch ihre Größe und ihre Technik bedrohlich, sondern auch aufgrund ihrer »kulturellen Fremdheit«: »Lauter Nerds, die sich nicht mehr an geschäftliche Konventionen halten, sondern mit lockerer Miene Revolutionen verkünden, und dabei verwaschene Jeans tragen.« Der 2011 verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs ist so etwas wie der »Gottvater« der »Disruption«; sein Name steht, um nur zwei Beispiele zu nennen, für Produkte wie den iPod oder das iPhone, die die digitale Welt verändert haben.
Der in Harvard lehrende US-Wirtschaftswissenschaftler Clayton Christensen, der die Theorie der »Disruption« entwickelt hat, bringt seine diesbezüglichen Forschungen dahingehend auf den Punkt, daß jedes noch so etablierte und erfolgreiche Unternehmen eines Tages von einer existenzbedrohenden Revolution bedroht sei. Disruptive Prozesse, so seine Überzeugung, seien notwendig für eine Weiterentwicklung des Marktes. Diese Prozesse gingen oft von Start-up-Unternehmen aus, weil erfolgreiche Unternehmen keinen Grund hätten, das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Das Management handelt also rational, wenn es auf kontinuierliche Verbesserung setzt.
Start-up-Unternehmen probierten, so Christensen, ihre neuen Ideen und Methoden zunächst auf Nischenmärkten aus, wo sie ihre Produkte optimierten. Danach attackierten sie etablierte Unternehmen auf breiter Front mit oft unschlagbar günstigen Angeboten. Christensen hebt hervor, daß mit seiner Theorie auch Voraussagen im Hinblick auf die Zukunft möglich seien und auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Universitäten oder das Bildungssystem, übertragbar sei, die ebenfalls auf disruptive Innovationen ausgerichtet werden müssen. Das Patent auf den Begriff »Disruption« meldete im übrigen aber Jean-Marie Druan, Vorstandsvorsitzender einer Werbeagentur, der ihn 1991 kreierte und schützen ließ.
Christensens Erkenntnisse sind keineswegs originell, klingt doch vieles, was heute unter »Disruption« kommuniziert wird, bereits bei einem der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts an, nämlich bei Joseph Schumpeter, den Christensen vor dem Hintergrund der digitalen Revolution quasi aktualisiert hat. Schumpeter indes sprach von »schöpferischer Zerstörung«, die er als wesentliches Kriterium des Kapitalismus ansah. Die anhaltende Innovationskraft von Unternehmern sei, so Schumpeter bereits vor über hundert Jahren, Auslöser »kreativer Zerstörung«.
Nur durch Innovationen, die gleichzeitig Bestehendes zerstören, seien Unternehmen in der Lage, sich auf dem Markt zu behaupten und im Wettbewerb durchzusetzen. Zugespitzt läuft das auf eine permanente Veränderungsbereitschaft hinaus, die Schumpeter als Voraussetzung wirtschaft- licher Dynamik ansah. Er sprach von einer Revolutionierung der Wirtschaftsstruktur »von innen heraus«, die unaufhörlich »die alte Struktur zerstört« und »unaufhörlich eine neue schafft«.
Klarzustellen ist eine Reihe von Mißverständnissen im Zusammenhang mit »Disruption«. Tobias Anslinger hat diese Klärung im Blog des Magazin für Kommunikationsmanager (KomMa) unternommen, wo er einige Fehldeutungen auszuräumen versuchte: Zum einen seien nicht die Märkte »disruptiv«, sondern vielmehr die »Innovationen im Sinne von Technologien«. »Disruptiv« – und nicht erhaltend – ist eine Innovation dann, wenn sie die Spielregeln auf dem Markt oder im Nutzungsverhalten verändert. Weiter steht das Mißverständnis im Raum, Digitalisierung schaffe per se »Disruption«. Nicht jede App und nicht jede »intelligente Maschine« wirkten auch gleich »disruptiv«. Schließlich wider- spricht Anslinger der Vorstellung, daß nur diejenigen Unternehmen, die sich »disruptiv« geben, um Innovation und Zukunftsorientierung zu signalisieren, erfolgreich seien.
Was Schumpeter und letztlich auch der Begriff »Disruption« zum Ausdruck bringen wollen, ist folgendes: Nicht die Größe eines Unternehmens ist entscheidend, sondern dessen Innovationspotential. Wem angesichts der Beständigkeit des Veränderungsdruckes Assoziationen mit der Idee einer »permanenten Revolution« kommen, wie sie ein gewisser Leo Trotzki in einem völlig anderen Kontext hegte, der liegt nicht ganz falsch. Entsprechend dramatisch konstatiert zum Beispiel der Journalist Christoph Keese, Cheflobbyist des Axel-Springer-Verlages: »Disruption heißt Unterbrechung.« Es sei »Chiffre für ein Lebensgefühl, eine Art Gehirnwäsche«. Motto für die richtige Methode, »Märkte zu attackieren und Marktführer zu verdrängen. Glaubensbekenntnis für eine vom Erfolg beflügelte Erfinderkultur, die weiß, daß sie alles erreichen kann, wenn sie nur radikal genug denkt«.
Keese hat 2013 ein halbes Jahr in Palo Alto im Silicon Valley zugebracht, um dort vor Ort die Folgen des digitalen Wandels insbesondere für die Medienbranche zu untersuchen. Der Journalist hat seine Erkenntnisse in einem Buch veröffentlicht – Silicon Valley. Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt (2014) –, das ei- nen Einblick in die Welt der angeblich grenzenlosen Innovation der US-Internet-Giganten eröffnet.
»Disrupt« sei, so Keese, das Mantra des Silicon Valley«; »wichtigstes Wort und zentraler Schlachtruf«. Ähnlich bekannt wie Christensen sei in Silicon Valley nur Charles Darwin und dessen Postulat: »Nicht die stärkste Art überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern die wandlungsfähigste.«
Diese Wandlungsfähigkeit zeitigt ihre Früchte dort, wo es Angreifern etablierter Unternehmen gelungen ist mittels digitaler Plattformen neue Märkte zu schaffen. Was das konkret heißt, hat zum Beispiel Google vorexerziert: Die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin erkannten 1996, daß je öfter eine Website im Internet verlinkt ist, desto interessanter ihr Inhalt in der Regel ist. Auf Grundlage dieser wenig spektakulären Beobachtung programmierten sie eine Suchmaschine, die der Konkurrenz deutlich überlegen war. Google machte in der Folge riesige Gewinne mit Werbung, die genutzt wurden, um den Kunden immer mehr digitale Dienste anzubieten.
Im Herbst 2008 gelang dann ein zweiter großer Wurf: Mit dem mobilen Betriebssystem Android wurde aus dem Suchmaschinen-Anbieter Google ein Plattform-Betreiber. Mehr als 80 Prozent aller Smartphones der Welt laufen mittlerweile mit Android, auf dem der App-Store von Google installiert ist. App-Entwickler, die erfolgreich sein wollen, müssen sich den Regeln des Plattformbetreibers Google – oder, bei dem Betriebssystem iOS, den Regeln von Apple – unterwerfen, um überhaupt in das Angebot des App-Stores aufgenommen zu werden. Dazu gehört auch, die hohen Margen zu akzeptieren, die Google oder auch Apple bei jedem Verkauf einstreichen. Alle anderen App-Plattformen erreichen bestenfalls Nischenmärkte.
Was für die Plattformmärkte App-Stores gilt, gilt mehr oder weniger auch für andere digitale Plattformen, wie sie zum Beispiel Amazon, Ebay oder auch Booking.com anbieten. Google versucht mittlerweile, neue digitale Plattform-Märkte zu erschließen. Dazu gehören laut einem Artikel des Wirtschaftsmagazins brand eins zum Beispiel vernetzte Energieströme im Smart-Home, vernetzte industrielle Produktion (in Deutschland »Industrie 4.0« genannt) oder Anwendungen rund um die Vernetzung von Fahrzeugen.
Plattformen erlauben einer großen Zahl Firmen, deren Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Auf ihnen gilt, so brand eins, »die gute alte Techniker-Regel: Wer die Norm macht, hat den Markt«. Hat sich eine digitale Plattform erst mal etabliert, führt an ihr kein Weg mehr vorbei, wozu unter anderem der »Netzwerk-Effekt« beiträgt. Die meisten Geschäftsmodelle, die auf Daten beruhen, sind fast immer Plattformen, bei denen Netzwerkeffekte gewissermaßen eingebaut sind, die der simplen Regel folgen: Je mehr Leute sich nämlich anschließen, desto mehr Leute können angesprochen werden.
Die Gewinne von Plattformbetreibern wie Google oder Apple sind entsprechend gigantisch – so wie die Machtposition, die ihnen zuwächst. Die Anbieter auf diesen Plattformen müssen sich zwar keinen Kopf mehr über die Vertriebswege oder die Infrastruktur derartiger Plattformen machen, unterliegen aber einem großen Preis- und Innovationsdruck aufgrund der Konkurrenzsituation, die vom Plattformbetreiber noch gefördert wird. Denn je mehr Wettbewerb auf einer Plattform herrscht, desto attraktiver ist das Angebot für die Endkunden. Der Weg an diesen Platt- formen vorbei wird in Zukunft für viele Unternehmen immer schwieriger. Denn je digitaler die Welt, desto mehr Plattformen etablieren sich. Entsprechend groß ist das Interesse der US-Netzgiganten, mit dem »zentralen Schlachtruf Disruption« (Keese) immer neues digitales Terrain zu erschließen und Marktkonkurrenten zu »zerreißen«.
Wie nun ist der »Disruptions«-Hype einzustufen bzw. welche Konsequenzen gilt es zu ziehen? Werden wir, wie der »Disruptions«-Apokalyptiker Keese meint, »verschwinden«, »weil wir in der Logik digitaler Märkte Effizienzbremsen sind«? Wird das »disruptive Denken« unsere Welt vollständig umkrempeln? Ist das, was früher gut war, nicht mehr gut, weil es nicht »neu« ist? Daß die Antwort in einer völlig anderen Richtung zu suchen ist, diese Erkenntnis ist der US-amerikanischen Historikerin Jill Lepore zu verdanken, die Mitte 2014 im Magazin The New Yorker mit einem einzigen Artikel die Dinge ins Lot setzte. Nicht nur daß sie Christensen, dem Guru der Lehre von der zerstörerischen Innovation, methodische Mängel nachweisen konnte.
Aus ihrer Sicht verfolge Christensens »atavistische« Botschaft vor allem eines, nämlich, Angst und Panik zu verbreiten. Letztlich spiegele, so faßte Wirtschaftswoche-Redakteur Ferdinand Knauß die Thesen von Lepore zusammen, »Disruption« nicht den Willen zur Innovation, sondern eher, wie stark die Nachfrage nach Innovation bei schrumpfendem Angebot sei. Verstehe man Innovationen als »Treibstoff der modernen Wachstumswirtschaft«, dann ist in Industriegesellschaften ein Anstieg der Produktion nur mittels neuer Produkte möglich.
Je saturierter die Konsumenten und je geringer die Zahl nachwachsender Konsumenten aufgrund demographischer Schrumpfung, desto größer der Zwang zu neuen, »hippen« Produkten. Diesen Erwartungen stehe aber eine nur geringe Zahl von Unternehmensgründern und Erfindern gegenüber. Die satten Erben in den westlichen Wohlstandsgesellschaften bringen also immer weniger Erfinderpersönlichkeiten hervor, dafür halten sie aber ein Überangebot von Kapital in ihren Händen. Hinter dem mit großer Emphase vorgetragenen Zwang zur »Disruption« steht also letztlich die Angst, daß den westlichen Wachstumsgesellschaften der »Treibstoff« ausgehen könnte.
Um nicht mißverstanden zu werden: Es gibt im Hinblick auf das, was sich im Moment als digitaler Transformationsprozeß abzeichnet, gerade auch aus deutscher Perspektive Handlungsbedarf. Mit Blick auf das aber, was als neuer »ökonomischer Stein der Weisen« (Knauß), der diesmal unter dem Begriff »Disruption« daherkommt, anmoderiert wird, drängt sich der Verdacht auf, daß es sich hier eher um einen künstlich geschürten Hype handelt, der vor allem im Interesse der US-Internetwirtschaft ist. Von den US-Netzgiganten ist bekannt, daß sie ansehnliche Summen in die Lobbyarbeit investieren, um ihre Einnahmen abzusichern. Daß die Theorie der »Disruption«, die die permanente technische Revolution predigt und die Gefahr beschwört, jedes Unternehmen könne jederzeit von Innovationen »zerrissen« werden, wie eine Art theoretischer Überbau dieser Lobbyarbeit wirkt, ist mit Sicherheit nur – Zufall.