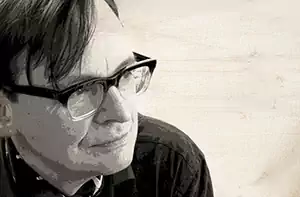Anfang Januar konstatierte die Süddeutsche Zeitung (SZ), virtuelle Konzerne wie Google, Facebook oder Amazon seien zu groß geworden. Alles schreie danach, »ihre Monopole aufzulösen«. Die meisten verschlössen »die Augen vor dem schleichenden Verlust der Privatsphäre«, andere glaubten, auf die Dienste dieser Internet-Giganten nicht verzichten zu können. Die SZ machte in diesem Zusammenhang jene Argumente geltend, die ökonomisch seit jeher gegen die Folgen von Monopolbildungen geltend gemacht werden. Abgehoben wird insbesondere darauf, daß Monopolisten durch ihre Marktmacht die Preise in die Höhe trieben und die »Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft« hemmten.
Wer sich dennoch mit Blick auf die vielen kostenlosen Angebote von Google oder Facebook zurücklehne, dem sei die Rechnung aufzumachen, daß die »Kunden mit der Gratis-Vergabe ihrer intimsten Daten einen viel höheren Preis [zahlten], als die Rockefellers und Vanderbilts einst für ihre Monopol- Dienste verlangten«. Auch wenn Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) oder Larry Page (mit Sergey Brin Google-Gründer) eher lässig daherkämen, seien sie ökonomisch gesehen »Radikalkapitalisten«.
Wer etwa die Gratis-Datensammelei begrenzen wolle oder die Firmen gar zwinge, Steuern zu zahlen, lerne schnell die andere Seite der »Turnschuh- Rockefellers« kennen. Ihr Einfluß gehe mittlerweile über wirtschaftliche Aspekte weit hinaus, weil sie gesellschaftsverändernde Umwälzungen in Gang setzten.
Hierfür stünden Begriffe wie fahrerlose Autos, »Internet der Dinge«, 3‑D-Drucker oder »Big Data«.
»Big Data« – auf deutsch Massendaten – dient in diesem Zusammenhang in der Regel als Sammelbegriff für digitale Techniken, die für eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung sowie deren gesellschaftliche Folgen steht. Grund für den Quantensprung des technischen Fortschritts ist das rasche Wachstum der Leistungsfähigkeit der Rechner, wovon unter anderem die Robotik, die Nutzung und Vernetzung riesiger Datenmengen oder die Künstliche Intelligenz (KI) profitieren.
Nicht wenige Experten, so zum Beispiel Klaus Schwab, Gründer und Chef des Weltwirtschaftsforums, sprechen deshalb von einer neuen industriellen Revolution, genauer: von der Vierten Industriellen Revolution, die durch die Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet sei, die die Grenzen der physikalischen, digitalen und der biologischen Sphäre verschwimmen lassen. Diese Revolution ist nicht einfach eine Weiterschreibung vorangegangener Umwälzungen. Die Schnelligkeit, Reichweite und vor allem die systemische Wirkung, die derzeit beobachtet werden kann, bedeuten eine Entwicklung im exponentiellen und nicht im linearen Tempo.
Die Vernetzung von immer mehr Menschen durch mobile Endgeräte, vor allem aber eine noch nie dagewesene Verarbeitungs- und Speicherkapazität, ermöglichen bahnbrechende technische Durchbrüche. Für diejenigen, die es sich leisten können, bietet der Aufbruch in die digitale Welt schon jetzt manifeste Vorteile, weil viele Dinge zeitsparender und effizienter geregelt werden können.
Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee, beide Ökonomen am Bostoner Massachusetts Institute of Technology (MIT), haben in ihrem Buch The Second Machine Age die großen Linien kommender Entwicklungen gezogen: Computer und andere digitale Errungenschaften hätten »auf unsere geistigen Kräfte die gleiche Wirkung wie die Dampfmaschine und ihre Ableger auf die Muskelkraft«. Da die Digitaltechnik eine Basistechnologie sei, ähnlich wie die Elektrizität, treibe sie die wirtschaftliche Entwicklung in allen Sektoren voran, und zwar nicht nur die der IT. Und das Tempo der Innovationen wird ihrer Ansicht nach sogar noch zunehmen; dabei werde das, was derzeit unter dem Schlagwort »Internet der Dinge« subsumiert wird, eine zentrale Rolle spielen.
In der US-Innovationsschmiede Silicon Valley bewirke dieses »Internet der Dinge«, so die bei- den Journalisten Marc Beise und Ulrich Schäfer in ihrem Buch Deutsch- land digital. Unsere Antwort auf Silicon Valley, derzeit eine regelrechte »Metamorphose«. Groß geworden sei das Tal mit »Handys, dem Internet, Suchmaschinen, Online-Shops und Dienstleistungen für Verbraucher«. Alles das sei aber nur ein Anfang gewesen. Nun bastele Silicon Valley an der »nächsten, sehr viel umfassenderen Ausbaustufe«. »Alles, wirklich alles, was unser Leben ausmacht, soll mit dem Netz verknüpft werden.« Künftig kommunizierten »Milliarden Maschinen und Geräte unentwegt miteinander«, tauschten riesige Datenmengen aus, glichen sie ab, über- prüften sie und lernten selbständig daraus. Das werde alles verändern:
»wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften und denken«.
Diese Einschätzung verweist darauf, daß wie bisher jede industrielle Revolution auch die digitale Revolution Chancen und Risiken eröffnet. Die Diskussion in Deutschland oszilliert dabei zwischen zwei Extremstandpunkten. Der eine Standpunkt lautet, das Thema »Digitale Revolution« sei angesichts der Innovationskraft der deutschen Wirtschaft eigentlich kein Thema, sondern eine Art »Medien-Hype«, einmal mehr durch das gekennzeichnet, was gern als »German Angst« bezeichnet werde. Das zweite Szenario ist das der Untergangspropheten. Die laufende aktuelle Industrielle Revolution werde, so ihre Überzeugung, jeden zweiten Arbeitsplatz vernichten, ohne daß hinreichend neue entständen.
Die einzigen, die profitierten, seien Programmierer, die als »Hohepriester« der Digitalisierung den Takt vorgäben. Alle anderen würden bestenfalls noch als Handlanger benötigt. Sprich: Nur wer beispielsweise Big-Data-Analysen beherrscht, hat einen sicheren Job. Der Politik empfehlen die beiden Autoren das kleine Einmaleins der Wirtschaftswissenschaften: Ein gutes Bildungssystem und Impulse für Startups sollen ebenso für die Digitalisierung rüsten wie eine moderne Infrastruktur und eine gezielte Anwerbung von Einwanderern.
Stichwort »moderne Infrastruktur«: Nur en passant sei hier erwähnt, daß Deutschland aufgrund eklatanter Fehleinschätzungen beim Auf- bzw. Ausbau des Glasfasernetzes mehr oder weniger das Schlußlicht unter den Industriestaaten darstellt. Wasser auf den Mühlen der Untergangspropheten ist auch die Diskussion um das Schlagwort »Disruption« (siehe hierzu ausführlich Sezession 78 /Juni 2017); einer Wortneuschöpfung des US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Clayton Christensen für das, was der 1950 verstorbene österreichische Ökonom Joseph Schumpeter als »schöpferische Zerstörung« bezeichnet hat.
Allerdings gibt es zwischen den US-Netzgiganten, die sich als Avantgarde disruptiver Strategien wähnen, und Schumpeters Wendung von der »schöpferischen Zerstörung« einen signifikanten Unterschied. Schumpeter ging davon aus, daß wir letztlich kein Wissen über die Zukunft hätten, die Zukunft also offen sei. Entsprechend lautete sein Imperativ, das Neue immer offen zu denken.
Die Politik aber, die Amazon, Facebook oder Google betreiben, läuft letztlich darauf hinaus, diese Offenheit zu eliminieren. Beispiele hierfür finden sich in der WiWo von Ende Dezember 2017, in der die Aktivitäten der US-Netzgiganten im Hinblick auf Gründer und Wettbewerber auf die Formel »Aufkaufen, kopieren, blockieren« gebracht wird.
Der Ruf der US-Netzriesen, für innovatives Unternehmertum zu stehen, weiche mehr und mehr dem Eindruck, so die WiWo, daß sie ihr Quasi-Monopol zum einen mehr und mehr abschotten, Konkurrenten einschüchtern oder aufkaufen oder Ideen »kopieren«.
Überdies griffen sie immer »neue etablierte Industrien und Märkte« an. Kritiker monieren, daß Innovationen nur noch in dem Rahmen stattfänden, den die virtuellen US-Konzerne zuließen. Die dahinterstehende Strategie ist unverkennbar: Konkurrenten, die Facebook gefährlich werden könnten, sollen per Aufkauf ausgeschaltet werden. So praktizierte es Facebook zum Beispiel mit YouTube, WhatsApp oder Instagram.
Es gibt aber mit Blick auf die heute übermächtig erscheinenden US- Netzgiganten auch ernüchternde Beispiele für verpaßte Chancen, über die unter anderem Tobias Kollmann und Holger Schmidt in ihrem Buch Deutschland 4.0 berichten.
Wären diese Chancen deutscherseits entschlossen genutzt worden, sähe – siehe Aufbau eines Glaskabelnetzes – die Internetwelt heute anders aus. Der Hamburger Verlag Gruner & Jahr, der 1997 mit der Entwicklung einer Suchmaschine namens »Fireball« begonnen hatte, ist ein weiteres Beispiel. Google gab es damals noch nicht. »Fireball« setzte sich bald an die Spitze der Suchmaschinen. Parallel dazu bereitete die Gruner & Jahr- Muttergesellschaft Bertelsmann den Börsengang des Internetportals Ly- cos Europe vor.
Die Verträge mit dem US-Partner Lycos Inc. untersagten aber den Betrieb einer zweiten Suchmaschine (neben Lycos). Fireball wurde deshalb an Lycos Europe verkauft, das ebenfalls kein Interesse an einer zweiten Suchmaschine hatte. Schließlich wurde Fireball in eine Tochtergesellschaft abgeschoben, wo die Suchmaschine »noch schneller verkümmerte, als Lycos Europe insgesamt. … Eine vielleicht historische Chance war dahin …«, konstatieren die Autoren.
Google hingegen nutzte entschlossen seine »windows of opportunities« auf dem Suchmaschinenmarkt und wartete im Herbst 2008 mit einem weiteren Paukenschlag auf: Mit dem mobilen Betriebssystem An- droid wurde aus dem Suchmaschinen-Anbieter Google ein Plattform-Betreiber. Gut 85 Prozent aller Smartphones der Welt (Stand 2014) laufen mittlerweile mit Android, auf dem der Play-Store von Google installiert ist. App-Entwickler, die erfolgreich sein wollen, müssen sich den Regeln des Plattformbetreibers Google – oder, bei dem Betriebssystem iOS, den Regeln von Apple – unterwerfen, um überhaupt in das Angebot des App-Stores aufgenommen zu werden. Was für die Plattformmärkte App-Stores gilt, gilt mehr oder weniger auch für andere digitale Plattformen, wie sie zum Beispiel Amazon, Ebay oder auch Booking.com anbieten.
Festzuhalten bleibt, daß Europa und damit auch Deutschland das Rennen um Privatkunden und die private Nutzung des Internet wohl bereits an die US-Netzgiganten Google, Apple, Yahoo oder Facebook verloren haben; laut Meinung vieler Fachleute ist der Vorsprung der Amerikaner nicht mehr aufzuholen. Daß sich die US-Geheimdienste wie die NSA dieses Potentials bedienen und mit den US-Netzgiganten kooperieren, um im globalen Wirtschaftskrieg mittels Datenabschöpfung zumindest im Westen die Spitzenposition der USA abzusichern, kann aufgrund der Dokumente, die zum Beispiel der »Whistleblower« Edward Snowden öffent- lich machte, als gesichert gelten.
Wie groß der Abstand Deutschlands zu den USA bereits ist, verdeutlicht eine Studie der deutschen Stiftung Internet Economy Foundation, die im April 2016 vorgelegt wurde. Auf eine Kennzahl sei hier vor allem verwiesen: Die zehn größten Netz-Unternehmen der USA waren zu diesem Zeitpunkt mehr als 1,7 Billionen Euro wert, während es die zehn größten deutschen »Rivalen« gerade einmal auf einen zweistelligen Milliardenbetrag brachten.
Tobias Kollmann, Beauftragter für Digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, und Focus-Chefkorrespondent Holger Schmidt bemängeln in ihrem Buch Deutschland 4.0, daß das Verständnis »für die bevorstehenden Änderungen im digitalen Zeitalter in der deutschen Wirtschaft nicht verbreitet« sei. Seitens der Produktions- und Fachbereichsverantwortlichen fehle nach wie vor die Einsicht darin, »in welchem Ausmaß technologische Entwicklungen die Geschäftstätigkeit ihres Betriebs ver- ändern werden«. Das Manko der deutschen Wirtschaft sehen sie vor allem in einem falschen Ansatz, der mit dem bereits erwähnten Schlagwort
»Industrie 4.0« verbunden sei: Die Digitalisierung der Fabriken reiche aus ihrer Sicht nicht aus, Wettbewerbsvorteile auf Dauer zu sichern. Die Kon- zentration auf Effizienzvorteile in der Produktion verstelle den Blick auf die »nötigen Innovationen auf der Produktseite, um die Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen«.
Mit Beise und Schäfer sind sich Kollmann und Schmidt einig, daß Deutschland gute Chancen habe, aufgrund seiner starken Position in der traditionellen Wirtschaftswelt auch eine führende Rolle in der digitalen Welt zu übernehmen. Doch dafür müßten aus den bisherigen Fehlern die richtigen Schlüsse gezogen werden, wenn verhindert werden soll, daß deutsche Maschinenbauer oder Autohersteller aus der ersten Reihe verdrängt werden. Nach Kollmann und Schmidt wird das zukünftige Wachstum davon abhängen, ob in Deutschland »eine digitale Marktorientierung, eine digitale Wettbewerbsfähigkeit« geschaffen werden kann. Die Leistung dürfe indes nicht am Werkstor enden. Ohne zielgerichtete digitale Standortpolitik werde Deutschland, darüber sind sich viele Fachleute einig, trotz guter Voraussetzungen weiter an Boden verlieren, ja ökonomisch womöglich abgehängt werden.
Die größten Erfolgsaussichten hat Deutschland bei der industriellen Nutzung des Netzes. Hier hätten Europa und allen voran Deutschland durchaus gute Chancen, einen Gutteil des Wachstums zu generieren, wenn die Weichen auch politisch in die richtige Richtung gestellt würden.
Gefordert ist hier insbesondere auch die Politik, deren Antworten auf die digitale Herausforderung bisher unbefriedigend sind. Das beginnt bereits bei dem Umstand, daß die Federführung für die Digitale Agenda auf drei verschiedene Ministerien aufgeteilt ist, nämlich die Ministerien Wirtschaft, Inneres und Verkehr. Es braucht keine tiefschürfenden Studien, um zu erkennen, daß diese Konstellation alles andere als effizient ist, selbst bei bestem Willen aller Beteiligten. So sieht es zum Beispiel auch der Blog Netzpolitik.org, betrieben von dem Journalisten Markus Beckedahl.
Für eine substantielle Verbesserung werden nach Kollmann und Schmidt derzeit drei Modelle diskutiert, die alle auf eine Bündelung der Zuständigkeiten hinauslaufen. Diese Bündelung hätte auch den Vorteil, daß Deutschland eine »klare und starke digitale Stimme nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch in Brüssel [habe], wo eine Vielzahl der relevanten Entscheidungen für den ›digitalen Binnenmarkt‹ in Europa
anstehen«. Es gäbe dann einen zentralen Ansprechpartner für die einzelnen Bundesländer, bei denen die Koordinierung der Umsetzung stattfinden müsse – zum Beispiel für die Themen Breitbandausbau und Bildung. Auf Landesebene halten die Autoren einen Staatssekretär für Digitales in den jeweiligen Staats- bzw. Senatskanzleien als Strategie- und Organisationsstelle für zielführend.
Beise und Schäfer fordern nicht nur einen Digital-Minister, sondern gleich eine Digital-Regierung, gehe es im »Internet der Dinge« doch nicht bloß um eine »isolierte Branche«, sondern um unser »gesamtes Leben und Arbeiten«.
Ob die Schaffung eines Digitalministeriums oder gar einer Digitalregierung wirklich eine adäquate Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung ist, darf zumindest bezweifelt werden. Wichtig ist die Schaffung zielführender rechtlicher und vor allem infrastruktureller Rahmenbedingungen, wofür es keiner Digitalregierung bedarf. Die deutsche Wirtschaft beweist jeden Tag, daß sie sehr wohl selbst in der Lage ist, Antworten auf die digitale Herausforderung zu finden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Nirgendwo finden sich im mittelständischen Bereich zum Beispiel so viele »hidden champions« wie in Deutschland. Diese Mittelständler aus den Branchen Maschinenbau, Elektro‑, Kfz- oder Medizintechnik bilden neben Konzernen wie Daimler, Siemens oder SAP die Basis des deutschen Wirtschaftserfolges. Weitere Weltmarktführer hat Bernd Venohr in seinem Lexikon der deutschen Weltmarktführer zusammengetragen. Deutschland ist in der Kombination von klassischer Ingenieurskunst mit Software nach wie vor führend in der Welt. Zwar gibt es in Deutschland kein »Silicon Valley«, aber es gibt »Hotspots« der Gründerkultur, so im Südwesten, in Berlin oder in München.
Der Unternehmensberater Bernhard Langefeld plädiert im übrigen dafür, den Begriff »digitale Revolution« niedriger zu hängen. »Die meisten sprechen von der digitalen Revolution«, äußerte er gegenüber der Zeit. »Aber im Bereich der Fabriken ist es eine Evolution, eine Entwicklung.« In diese Richtung gehen auch die Argumente des Historikers Andreas Rödder, der in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin brand eins »einen weiteren Beschleunigungsschub einer größeren, übergreifen- den Entwicklung« ortete, »die spätestens mit den ersten Eisenbahnen des 19 Jahrhunderts einsetzte«; er sieht nicht »den großen Bruch«, sondern »vielfältige Transformationsprozesse«, die vor gut 100 Jahren mit der Elektrifizierung eingesetzt hätten. Diese Schübe werden von Untergangs- ängsten und Erlösungshoffnungen begleitet.
Rödder spricht von einem »Triple A« im Umgang mit technischem Wandel: »Angst, Abwehr und Adaption«. Das liegt in der Natur des Kapitalismus, der eine einzige Abfolge produktiver Zerstörung sei. Zur Beweglichkeit des Kapitalismus gehöre, so Rödder, daß »er auch Antworten auf die von ihm produzierten Probleme zur eigenen Weiterentwicklung nutzen kann«.
Daß diese »produzierten Probleme« noch in einer ganz anderen Richtung liegen könnten, als die Auguren der Digitalisierung suggerieren, versucht der US-Ökonom Robert J. Gordon zu vermitteln. Er glaubt, daß die »Innovationsreserven« der »digitalen Revolution« »nicht die Macht [hätten], bedeutende Produktivkräfte zu entwickeln, wie das Anfang des 20. Jahrhunderts geschah«. In den USA etwa, so Gordon in einem Interview mit brand eins, wachse »die Produktivität so langsam wie nie zuvor«. Seit Mitte der 1990er Jahre hätten wir, »abgesehen vom Smartphone, keine großen Sprünge mehrgemacht«.
Womöglich ist der Blick Gordons zu sehr auf den Westen fixiert, spielt sich doch China derzeit auch im Hinblick auf die Digitalisierung mehr und mehr nach vorn; dort geht auch die Digitalisierung deutlich schneller voran als in Europa. China ist bereits Weltmarktführer für Solarzellen, Handys, Mikrochips, Displays oder Drohnen. Die Zeit, in der das Land vor allem als Imitator westlicher Technik in Erscheinung trat, gehören mehr und mehr der Vergangenheit an, wie die große Zahl der angemeldeten Patente zeigt – laut Frankfurter Rundschau mehr als eine Million im Jahr 2016 (Deutschland kommt auf etwas mehr als hunderttausend). Mit anderen Worten: Mit dem Hype um die »Nerds« von Silicon Valley als Inbegriff des Fortschritts ist ein gehöriges Maß an Autosuggestion verbunden. Der Atem der chinesischen Konkurrenz ist nämlich bereits zu spüren.