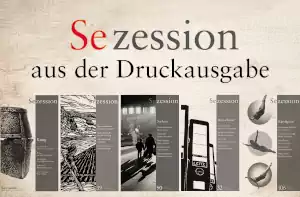Die große Wende blieb erneut aus. Vor allem seit der Corona-Krise kann man bei vielen widerständigen Menschen eine gewisse Frustration erkennen.
Sie hatten sich durch Wahlen, Demonstrationen und Petitionen ein Umdenken der Eliten und grundsätzliche politische Veränderungen erhofft. Dieser Trugschluß kommt zustande, da die meisten Bürger Politik auf Parteipolitik reduzieren und Metapolitik ignorieren. Ebenso verkürzt ist es, die Lösung politischer und gesellschaftlicher Probleme allein oder zuerst vom Staat zu erwarten.
Der heutige Staat beachtet diese Forderungen meist gar nicht oder gibt nur vor, sich damit auseinanderzusetzen. Denn er ist weitestgehend von den Interessen und Vorgaben supranationaler Institutionen, multinationaler Konzerne und informeller globaler Netzwerke gelenkt, wodurch der politische Entscheidungsprozeß durch den Bürger immer weniger beeinflußt werden kann. Davos, Washington, Brüssel und Berlin liegen in jeder Hinsicht außerhalb des eigenen Einflußbereichs. In diesem kafkaesken Szenario steht heute der einzelne big government und big business gegenüber und ist deren Einflüssen bis ins Privatleben hinein schutzlos ausgeliefert.
Diese Ohnmacht des einzelnen ist Ergebnis des Niedergangs eines gesellschaftlichen Bereichs zwischen Individuum und Staat. Bis in die frühe Moderne hinein war der Mensch eingebunden in ein Geflecht vielfältiger Gemeinschaften wie Pfarreien, Zünfte, Gilden, Genossenschaften, Gesellen- und Arbeitervereine, geistliche Bewegungen, Bruderschaften und anderes. In diesen wurde das gesellschaftliche Leben organisiert. Daneben besaßen »Gemeinden mit gewählten Selbstverwaltungsorganen und weitgehender Selbständigkeit in der Wahrung von Frieden und Recht und der Regelung ihrer inneren Angelegenheiten, etwa solchen wirtschaftlicher Natur«, eine hohe Bedeutung (so der Historiker Wolfgang Reinhard).
Diese subsidiäre Aufteilung von Verantwortung und Entscheidungsgewalt erzeugte, so der Historiker Michael Mitterauer, »eine vielfach in sich gestaffelte Herrschaftsordnung, in der es vielfältige Mediatgewalten gab«, die bei Aristoteles und Thomas von Aquin in dem vereinfachten Schema homo, domus, vicus, civitas, provincia/regnum geordnet wurden. Die oberste Ebene der weltlichen Autorität, etwa in Person von Kaiser, König oder Fürst, war im Alltag wenig präsent oder relevant – im Gegensatz zu den zahlreichen Zwischengliedern, in die der Mensch auf natürliche Weise eingewoben war. Die vormoderne Ordnung war somit einerseits ein engmaschiges Sicherheitsnetz, das den direkten Zugriff der politischen Gewalt auf den einzelnen und sein Umfeld verhinderte.
Andererseits ermöglichte ihm dies auch die konkrete Mitgestaltung seiner Lebenswelt. In Gemeindeversammlungen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit wurde zum Beispiel über »die Nutzung der Allmende, die Zuteilung von Holz, die Regulierung der Weiderechte, die Ausbeutung von Salinen, die Verbesserung infrastruktureller Maßnahmen durch den Bau von Brücken, den Unterhalt von Wegen, die Einrichtung von Badstuben und Backhäusern, die Regulierung der Märkte, die Verminderung der Brandgefahr und die Umlage der Steuern« (Peter Blickle) entschieden.
Das bis auf die lokale Ebene ausdifferenzierte Kulturleben dieser Gemeinschaften, das sich in eigenen Trachten, Festen, Schutzpatronen, Bräuchen, Architekturstilen usw. ausdrückte, stiftete darüber hinaus Identität und Solidarität. Die sich daraus entwickelnden Bindungen waren »intensiv und dauerhaft, weil sie nach dem Vorbild häuslicher, familiärer, verwandtschaftlicher Beziehungen entwickelt wurden« (Mitterauer).
Durch die Zentralisierung von Politik und Wirtschaft im Zuge von Merkantilismus, Absolutismus und Industrialisierung verloren die Zwischenglieder zunehmend an Bedeutung, bis die Französische Revolution ihnen den Todesstoß versetzte: Im August 1789 wurden die Stände abgeschafft, im März 1791 folgten die Zünfte. Zehntausende französische Gemeinden verloren bis in Napoleons Herrschaft hinein ihre Eigenständigkeit und wurden zu untersten Verwaltungsbehörden des neuen mächtigen Zentralstaates: »Politische Kreativität und normative Wertschöpfung erfolgen seitdem nicht mehr aus den Kommunen, sondern nur in Formen sehr viel abstrakterer Repräsentation über die Parlamente.« (Blickle)
Der Rest Europas zog im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte nach. Es muß betont werden, daß im Gegensatz dazu etwa die Einführung der Gewerbefreiheit im Zuge der Stein-Hardenbergschen Reformen, die politische Repräsentation durch Parteien und die Verlagerung des Solidarsystems auf den Nationalstaat durch die Bismarcksche Sozialgesetzgebung nicht in zerstörerischer Absicht, sondern aus epochenbedingter Notwendigkeit geschahen. Im Rückblick jedoch trugen diese und andere zentralisierende und monopolisierende Maßnahmen zu einer – freilich nicht linear verlaufenden – Entwicklung bei, in der das Kleine, Lokale und Konkrete zugunsten des Großen, Globalen und Abstrakten geschwächt wurde.
Den vorläufigen Höhepunkt kann man heute in der Auflösung der Familie, im Aussterben von Kirchen, Gemeinden, Vereinen und im Ruin oder der feindlichen Übernahme kleiner und mittlerer Unternehmen durch global agierende Konzerne beobachten. Das Zwischenfazit zog bereits Papst Pius XI. in Quadragesimo anno (1931): »In Auswirkung des individualistischen Geistes ist es so weit gekommen, daß das einst blühend und reichgegliedert in einer Fülle verschiedenartiger Vergemeinschaftungen entfaltete menschliche Gesellschafsleben derart zerschlagen und nahezu ertötet wurde, bis schließlich fast nur noch die Einzelmenschen und der Staat übrigblieben« – wobei letzterer, wie gesagt, seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert einen Großteil seiner Macht an größere Akteure abgegeben hat, was die Distanz zwischen beiden Polen noch erweitert hat. Natürlicher und gewachsener Gemeinschaften beraubt und entgegen seinem sozialen Wesen bleibt der Mensch atomisiert zurück. Er geht in einer Masse verloren, die durch staatliche Repressionen, mediale Manipulationen und scheinbar allzeit verfügbare Konsumangebote leicht kontrollierbar ist.
Die Konsequenzen dieser Entwicklung verdeutlichen »die Notwendigkeit einer Wiederherstellung der vermittelnden Körperschaften« (Alain de Benoist) als große politische Aufgabe unserer Zeit. Dafür müssen zunächst die Menschen in der eigenen Umgebung aus der Isolation geholt werden. Der erste Schritt in diese Richtung wurde bereits getan, als besonders im Zuge der Corona-Krise Aktivismus und Protestbewegungen dezentralisiert wurden und dadurch trotz negativer Berichterstattung neue Mitstreiter und Unterstützer vor Ort gewonnen werden konnten. In den Phasen zwischen den in der Zahl zunehmenden Ausnahmezuständen kann schließlich ein gewisser lokaler Organisationsgrad erreicht werden, um die weitere Zersplitterung der Kräfte zu verhindern.
Doch bei der Vernetzung darf nicht haltgemacht werden. Es muß konstruktiv an etwas gearbeitet werden – im kommunalpolitischen, gegenkulturellen, wirtschaftlichen, karitativen und religiösen Bereich. Ob dafür die Restbestände berufsständischer Körperschaften, Bürgerdialoge, Bürgerräte oder Regionalbewegungen genutzt und aus ihrer politischen Bedeutungslosigkeit geholt werden können, muß im Einzelfall ausprobiert werden. Auch unscheinbare Ansätze wie Handwerkerringe, Gemeinschaftsgärten, Nachbarschaftshilfen, Schlacht- oder Backhäuser besitzen Potential, wenn sie wiederbelebt und in das lokale Leben eingebunden werden.
Grundsätzlich ist der Aufbau von Zwischengliedern in verschiedenen Leitstrategien möglich. Es lassen sich dadurch sowohl kurzfristig aufgezwungene Maßnahmen abwehren als auch langfristig eigene positive Akzente setzen. Die Fernziele können dabei in mehrere Zwischenziele unterteilt werden, wodurch die jeweiligen Mittel konkreter und die Erfolge sichtbarer werden. Wenn so die Wirkung des eigenen Engagements deutlicher wird, sollten auch Motivation und Mobilisierungspotential steigen. Dabei ist man nicht nur auf den ländlichen Raum beschränkt, sondern kann auch in Stadtvierteln beginnen, wo die Linke des englischsprachigen Raums seit langem community building theoretisch erforscht und praktisch erprobt.
Damit soll nicht der naiven Vorstellung einer Schwarmintelligenz das Wort geredet oder gar eine prinzipielle Staatsverachtung befördert werden. Im Gegenteil wird der Staat durch den föderalen und hierarchischen Aufbau der Zwischenglieder im Sinne des Naturrechts wiederhergestellt. Denn »je besser durch strenge Beobachtung des Prinzips der Subsidiarität die Stufenordnung der verschiedenen Vergesellschaftungen innegehalten wird, um so stärker stehen gesellschaftliche Autorität und gesellschaftliche Wirkkraft da, um so besser und glücklicher ist es auch um den Staat bestellt« (Pius XI.). Nicht zuletzt stellt man sich damit in eine bedeutsame historische Kontinuität, da dieses »Flechtwerk aus reziproken organischen Bündnissen« auch »die traditionelle organisatorische Struktur des Reiches« (Benoist) bildete.