Der IQB-Bildungstrend und eine aktuelle Studie der Kultusministerkonferenz zur Grundschule weisen das aus. Hier wurde das bereits thematisiert.
Grund für den Schwund an elementaren Befähigungen ist das Schulsystem selbst. Falsche Entscheidungen der Bildungspolitik führten dazu, daß die Schule in ihren Kernbereichen mittlerweile dysfunktional erscheint; es gelingt ihr immer weniger, kulturelle Standards zu vermitteln, die vor Jahrzehnten ganz selbstverständlich waren. Die Lehrkräfte sind engagiert und ringen mehr denn je mit enormen Belastungen, laufen aber meist kritiklos und autoritätsgläubig in falscher Richtung mit.
Schon weil genau jene Pädagogik noch weiter forciert wird, die in das Dilemma führte, ist von der gegenwärtigen Politik und ihrer fragwürdigen Anthropologie keine Besserung zu erwarten. Aktuell verspricht man sich die vorzugsweise von technischen Innovationen, also von Laptop- und Tablet-Klassen und von teuren Smart-Boards. Aufrüstung der Peripherie bei hohlen Kernen. Die neuen Geräte werden über ihre Funktion als Werkzeuge hinaus fetischisiert, als würde ein Mittel, ein Medium, ein Tool ausgleichen können, was an Inhalten und Befähigungen fehlt.
Die Digitalisierung kann wegen der investierten Milliarden durchaus funktionieren, aber das wird bei der nachzuholenden Alphabetisierung und Literarisierung nicht helfen. Gar nicht, im Gegenteil. Dazu bedürfte es veränderter Zielstellungen und eher einer Rückbesinnung auf ruhiges und gründliches Vermitteln von Grundbefähigungen und auf den reichen Fundus literarischen Erbes. Das nervöse Klicken und Wegklicken, Scrollen und Wischen verstärkt das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, aber Lesebücher, über Jahrzehnte der Eintritt in die Literatur, gelten als unmodern und werden daher kaum mehr verlegt, sogenannte Ganzschriften überdies immer weniger vollständig gelesen.
Im Sinne vermeintlicher Bildungsgerechtigkeit und Inklusion sind seit dreißig Jahren Inhalte reduziert, Anforderungen gesenkt und Bewertungen inflationiert worden. Interessante und herausfordernde Themen verschwanden zugunsten der Herausbildung sogenannter Methodenkompetenz. Indem man Inhalte ausdünnte und auf echte Qualifikation verzichtete, wurde der Unterricht nicht nur weniger anspruchsvoll, sondern damit langweiliger und fader. Inspiration kann nur noch von besonderen Lehrerpersönlichkeiten ausgehen, die inoffiziell antizyklisch unterwegs sind und über eine Bildung verfügen, die das Berufsbild selbst nicht mehr voraussetzt.
Weshalb aber überhaupt lesen, wofür Literatur? – Die Kultusbürokratie, häufig von Nichtlesern besetzt, faßt das Lesenkönnen allzu technisch und rein pragmatisch als eine „Kompetenz“ auf, so als bräuchte es die um ihrer selbst willen. Schüler sollen einfach lesen können, klar. Aber Lesen und Literatur sind mehr als eine bloße Technik, und wenn das Vermögen immer weiter verloren geht, fehlt damit mehr als nur eine bloße Befähigung zu irgendwas.
Die Entwicklung des Menschen begleitete sein Bedürfnis, Geschichten zu erzählen und zu hören. Diese fiktionalen Erzählungen ließen uns von jeher aufmerken, gerade wenn sie der Phantasie entsprangen; sie übten unser anpassungsorientiertes Bewußtsein und gaben unserem Sozialleben wichtige Impulse. An Literatur konnte unser Geist für die Wirklichkeit proben. Jedes Kind bekommt gern etwas vorgelesen; es spürt ganz ursprünglich die Anziehungskraft des Fiktionalen.
Steven Pinker beschreibt das so:
„Das Leben ist wie ein Schachspiel, und Geschichten sind gewissermaßen Bücher mit berühmten Schachpartien, die gute Spieler studieren, damit sie auf ähnliche Situationen vorbereitet sind.“ – Unserem Geist wird also ein Erfahrungsschatz vermittelt, auf dessen Grundlage er sich selbst ausprobieren kann.
Was genau aber zieht uns an Erzählungen, an Literatur an, was löst die Spannung in uns aus? –
Der Kern allen Erzählens und jedes Dramas ist der Konflikt. Lesend werden wir Zeuge von Schwierigkeiten, von Ärger, Not und dem Ringen mit Leidenschaften, uns werden tiefe Schuld und verzweifelte Sühne geschildert. Wir sind davon gefesselt, wie die literarischen Gestalten ihre Ziele verfolgen und dabei Widerstände überwinden – oder wie sie tragisch scheitern müssen. Ohne das Erlebnis dieser uns selbst grundvertrauten Konflikte, dieses menschlichen Dramas würden wir nicht weiterlesen, sondern uns langweilen.
Es soll also dramatisch sein, es soll uns packen, im Krimi, im Thriller bis ins Extrem, auf daß wir unsere Erfahrungen mit dem Gelesenen abgleichen, uns dabei positionieren, mit den Gestalten mitfiebern und ihre Situationen und Handlungen permanent beurteilen. Wir lesen, weil wir uns mit den Helden der Literatur vergleichen wollen; wir gleichen unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen mit ihnen ab, wir fragen uns: Wie würde ich mich in diesem Konflikt verhalten?
Wir ordnen uns ein, so wie wir das in tatsächlichen Konflikten des Alltags ebenso tun. Wir üben uns, lesend, fürs Leben; wir entdecken literarische Figuren, die wir vorbildlich finden und bewundern, und wir hassen deren Gegenspieler. Jedes Buch stellt also eine umfassende kognitive und emotionale Trainingseinheit dar.
Mit Joyce Carol Oates ist das Lesen „das einzige Mittel, mit dem wir unwillkürlich und oft hilflos in die Haut eines anderen schlüpfen, in die Stimme des anderen, in die Seele des anderen … und in ein Bewußtsein eintreten, das uns nicht bekannt ist.“
Können Heranwachsende immer weniger lesen, so fehlt ihnen nicht einfach nur eine Befähigung unter anderen, sondern überhaupt der Zugang zu Mythen, Geschichten und Fabeln, die der Schlüssel zu unserem seelischen und sozialen Wesen sind. Zudem bedürfen wir ihrer als Verbindung zum Geist und zum Empfinden unserer Mitmenschen. Man könnte das erweitern, etwa auf die Musik und insbesondere den Gesang. Es wird nicht nur weniger gelesen, sondern gleichfalls weniger gemeinsam gesungen.
Alle Mythen suchen danach, wohin wir Verlorenen in dem ganz großen Bild der Welt gehören. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Wo ist der Halt unterm schwankenden Grund des Daseins? Mag sein, deswegen der Hang zum trivialisierten Mythos, also zur Fantasy-Literatur oder deren eigener Schwundform, den technisch so perfekt und faszinierend aufgezogenen Computerspielen, die Heranwachsende in ihren Bann ziehen. Besser als nichts, eingestanden, aber diese Medien reichen zu viel zu, sie bedienen die Phantasie eher passiv, als sie aktiv zu mobilisieren.
Joseph Campbell sprach vom „Monomythos“, einer Schablone für alle Geschichten von Belang, nach der ein zunächst widerstrebender Held zum Handeln aufgefordert wird, sich in Abenteuer stürzen, leiden, sich bewähren muß, um nach langer Reise gereift nach Hause zurückzukehren. Diese Reise aber ist unser aller Leben, ob wir uns nun als Held sehen mögen oder nicht. Gewissermaßen brechen wir alle wie Parzival zu unseren biographischen Irrungen auf.
Eine einzige Geschichte, etwa Ambrose Bierce‘ „Der Zwischenfall an der Eulenfluß-Brücke“ oder Isaak Babels „Der Tod Dolguschows“, kann das Wesen und damit die Not unserer Existenz unmittelbar auf wenigen Seiten einfangen.
Mythen, aber gleichsam Literatur widmen sich den ganz großen Themen, also der Erfahrung des Todes und der Angst vor Auslöschung und Verschwinden. Leben und Tod als Doppelaspekte des Daseins. Wenn wir über unseren Ursprung nachsinnen, stellen wir gleichsam die Frage nach unserem Ende. Darüber nachzudenken, wie wir unser Leben führen, heißt darüber nachzusinnen, daß der Tod unausweichlich ist. Für unserer Hier und Jetzt ist das eine dominierende Erkenntnis, die uns existentiell der Verantwortung für ein möglichst sinnvolles Leben von Wert unterwirft. Starke Literatur thematisiert das.
Insofern problematisch, daß der Deutschunterricht in der Oberstufe reduziert auf das Analysieren von Texten, weniger auf die Interpretation abstellt. In Nachahmung germanistischer Oberseminaren werden Textfiguren und Stilmittel gesucht, aber im Verlaufe dieses dilettantischen Sezierens geht die eigentliche Wirkung der Literatur an den Abiturienten vorbei. Ergiebiger wäre es, übergreifende geistesgeschichtliche Zusammenhänge und Themenbezüge zu erkennen oder überhaupt zu erlesen, was einen an dem literarischen Stoff wirklich entfacht. Oder warum er einen eben nicht entzündet.
Der klassische deutsche Schulaufsatz ging früher von Themen und Problemen aus, er verlangte Reflexion, Positionierung und Urteil, gab also subjektiver Widerspieglung Raum. Mittlerweile sollen Texte über Literatur lediglich unverstanden eingepauktes steriles Theoriewissen anwenden.
Verstehen Heranwachsende also immer weniger zu lesen, so fehlt ihnen damit nicht nur das Vermögen, Buchstaben aneinanderzureihen, Worte und Sätze und pragmatische Texte zu verstehen, sondern sie verlieren überhaupt den Anschluß an die Stoffe, die unser menschliches Wesen illustrieren und problematisieren.
Wenn nach moderner Methodik schon Lehrern Texte schnell als viel zu lang gelten, wenn das exemplarische Prinzip dominiert, also nurmehr Auszüge aus Werken gelesen werden, wenn Abiturienten kaum das Feuilleton der großen Tageszeitungen verstehen können, auch das alles angeblich zu lang, viel zu lang, dann ist das mit enormem Schwund an Eigenkultur verbunden. Ganz abgesehen davon, daß es nun mal an Muße und Zurückgelehntheit fehlt. Oder einfach an der guten alten Lesecouch.
Der Anschluß an die europäischen Quellen, zu gewährleisten nur über die alten Sprachen und die Kenntnis des Christentums, ist außerhalb von ein paar letzten liebenswerten Forschungsbereichen bereits völlig verloren. Nunmehr droht der Link zu den großen literarischen Stoffen auch der Moderne aufgelöst zu werden. Alles – im Wortsinne – dekonstruiert und nur noch über die Spickzettelsammlung Wikipedia zu erlesen. Information statt Bildung.
Klar kann die Mehrheit der Kinder noch lesen. Wenn „nur“ 44 Prozent am Ende der Klasse vier den Regelstandard nicht erreichen, dann sind immerhin noch über die Hälfte der Kinder des Lesens mächtig. Und wenn „nur“ zwanzig Prozent aller Neuntkläßler in deutschen Schulen laut PISA-Test als funktionale Analphabeten gelten, dann können achtzig Prozent noch etwas mit Literatursprache anfangen. Aber was ist mit dem Rest, der diese Kultur verlor? Er bildet eine Art Verfügungsmasse, der eigene Ortungen und Urteile zeitlebens schwerfallen werden.
Sind das nicht die sogenannten einfachen Leute, jene, die früher ihren Kindern aus Märchenbüchern vorlasen? Das war doch Hochkultur.
Die Kultusbürokraten geben sich nach dem jeweils nächsten deprimierenden Test kurz betroffen, machen dann aber in gleicher Richtung weiter und verstehen die Schule vorzugsweise noch als einen sozialpädagogischen und vor allem politischen, also staatsbürgerkundlichen Veranstaltungsort.
Hier im Kommentariat wird gern nach Lösungen gerufen. Gesellschaftlich gibt es derzeit keine. Die Bildungspolitik ist in ihren selbsterfüllenden Prophezeiungen verrannt, und selbst die gängigen Tests folgen Meßverfahren, die das eigentlich Defizitäre kaum in den Blick nehmen. – Zwar stellt die AfD richtige Anträge, bringt die Probleme also in den politischen Entscheidungsverlauf ein, wird aber durchweg geblockt.
Alles zu Ändernde obliegt längst der individuellen Verantwortung: Mut zum Buch, Kindern spannende Geschichten vorlesen, gemeinsam Illustrationen beschreiben, also versuchen, die Lust aufs Lesen zu wecken.
– – –
Heino Bosselmann hat jüngst das Kaplaken Alterndes Land vorgelegt – hier bestellen.
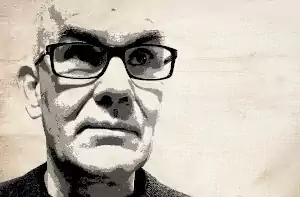
brueckenbauer
Die sogenannten "einfachen Leute" waren früher nicht diejenigen, die ihren Kindern aus Märchenbüchern vorlasen, sondern die, die ihren Kindern Märchen erzählten, weil sie selbst nicht lesen konnten. Das Lesen wurde von oben eingeführt - damit die Leut besser wussten, was die Regierung von ihnen wollte.