Und der Trumpismus erscheint in seinem Wesen noch unbestimmt. Falls er’s geschichtsfest überhaupt zu einem Ismus bringt. Er probiert sich offenbar empirisch aus und erwirbt seine politische Gestalt im praktischen Testen, was möglich ist. Eines scheint jedoch erweislich:
Auf Dezisionismus und den konsequenten bis skrupellosen Gebrauch der Macht versteht sich die Rechte letztlich besser als die Linke, was wiederum deren antitrumpistische Hysterie erklärt. Mit den checks and balances ist es so weit her offenbar nicht, wenn in politischen Turbulenzen Schmittianisches Denken regiert und die Exekutive die Judikative ignoriert. Abwarten, wie sich insbesondere die Differenzen zwischen diesen beiden Bereichen entwickeln.
Christoph Möllers hat in der FAZ vom 9. April 2025 nachgewiesen, weshalb Trump so verblüffend stark durchregieren kann:
Zudem ist der amerikanische Kongress kein Debattenparlament. Seine Arbeit geschieht in den Ausschüssen. Die politische Lage im Ganzen wird nicht erörtert, sondern bestenfalls in Einzelfragen debattiert. Auf den Bericht des Präsidenten zur Lage der Nation gibt es keine Aussprache, sondern nur eine im Fernsehen eingespielte Erwiderung. Der Mangel an solidarischer Gemeinsamkeit von der Regierung heimgesuchter Universitäten und Kanzleien findet in der Fragmentierung der parlamentarischen Arbeit sein politisches Abbild. Aber auch sonst passiert wenig im Kongress: Als Gesetzgeber war er schon lange vor Trump ein Ausfall, so wie das Regieren mit Präsidialdekreten bereits unter Obama in Mode kam. (…)
Auf Politisierung des Rechts antwortet Gegenpolitisierung. Oben wartet der zu zwei Dritteln republikanische Supreme Court. Doch selbst wenn das Gericht eine andere politische Zusammensetzung hätte, wäre es nicht einfach, mit Mitteln des Verfassungsrechts an den Kern der institutionellen Krise, den freiwilligen Machtverzicht des Kongresses, zu kommen. Das amerikanische Gerichtsverfahren ist strikt auf die Überprüfung von Konflikten zwischen Streitparteien bezogen. Wenn der Kongress seine Arbeit als Gesetzgeber und Kontrollorgan der Administration freiwillig einstellt, schafft das kein justiziables verfassungsrechtliches Problem.
Ihren Beitrag zur Entwicklung hat schließlich auch die Law School. Wie jede Juristenausbildung ist die amerikanische eine Schule der Anpassung, aber eine, welche die Studenten gleich noch jeder Illusion über den Eigenwert des Rechts beraubt. Dies geschieht auf einem extrem hohen Niveau, und gerade deutsche Juristen, die oft etwas zu innig an die objektive Richtigkeit ihrer Dogmen glauben, können in den Vereinigten Staaten rechtskritisches Denken lernen. Zu lernen ist dort aber auch, dass eine Ordnung das Vertrauen darauf benötigt, dass ihre Inhalte nicht einfach politisiert werden. Eine als bloße Machttechnik durchschaute Normativität des Rechts bindet auf Dauer nur die Schwächeren, zu denen die im Einzelkampf geschulten Juristen im Zweifel nicht gehören werden.
Wenngleich man „The Donald“, zurückhaltend formuliert, als höchst fragwürdigen und mindestens instabilen Charakter empfinden mag: Die in den USA entstandene Wokeneß, maßgeblich ausgehend von den Bürgersöhnchen und höheren Töchtern an den Elite‑, also den teuren Bezahl-Universitäten, ist noch weit fragwürdiger und bedurfte eines wirkungsvollen Korrektivs. Grober Keil, auf groben Klotz gesetzt. Nur Trump konnte das so entschieden beginnen.
Ähnliches gilt für die AfD. Man kann sie insgesamt und insbesondere manche ihrer bizarren Selbstprofilierer mit Skepsis betrachten, aber sie stellt das einzige Gegengewicht von Rang dar; politisch gibt es kein wirksameres. Ohne die AfD ist hierzulande überhaupt keine Korrektur denkbar.
Und schon deswegen ist jeder anzuerkennen, der couragiert Haltung bezieht. Bei so fulminantem Gegenwind können Kritiker in intoleranten Zeiten nicht durchweg mit Contenance agieren. Wird man kriminalisiert, fällt’s zuweilen schwer, mit geduldigem Langmut distinguiert und kultiviert aufzutreten.
Was man der AfD entgegenschlägt, ist weit krasser als die von ihr ausgehende Kritik, denn von links bis CDU wird der offene und freimütige Diskurs hart blockiert und stattdessen der Alternative mit vollem Affront begegnet: Ihr wäret besser nicht! – Das geht aufs Ganze. Die AfD kann dem gegenüber nicht einfach freundlich sein und als „Spielregeln“ übernehmen, was die Gegenseite selbst nicht mal ansatzweise einzuhalten bereit ist.
Feindschaft von links geht derzeit weit, exekutiv und judikativ unterstützt. Diese Feindschaft beherrscht nicht nur die Debatte, sie zielt auf Eliminierung. Man denkt an eine letzte Konsequenzen aufzeigende Aussage in Carl Schmitts „Der Begriff des Politischen” (1932):
Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, daß sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Krieg ist nur die äußerste Realisierung der Feindschaft.
Die Eigendynamik sich selbst forcierender ideologischer Bewegungen hat mich immer interessiert. Faszinierend, mit welcher Konsequenz Welt- und Menschenbilder revidiert werden und wie fruchtbar politische Sendungen auf tiefe Bedürfnisse treffen – im Falle der Wokeneß offenbar auf die Komplexbeladenheit und somit die Erlösungswünsche des liberalen und sozial-demokratischen Establishments.
Namentlich diesen Herrschaftskräften und Wohlständlern scheint mit der Globalisierung und den daraus resultierenden Extraprofiten mit erschrockenem Erstaunen bewußt geworden, daß sich ihr Luxus schon historische genau dem verdankt, was sie eifernd anzuprangern beginnen: Kolonialismus, Diskriminierung und Ausbeutung, paternalistisch hierarchische Strukturen, Eurozentrismus.
Hat es Amerika wirklich besser? Keinesfalls. Daß die eigene Geschichte mit einem Völkermord an der indigenen Bevölkerung begann und den Nachfahren der schwarzen Sklaven erst seit 1965 widerwillig das Wahlrecht gewährt wurde, dringt erst jetzt ins Bewußtsein und steht der romantisch verkürzten Geschichte entgegen, vor allem und zuerst eine der ältesten Demokratien und so Zufluchtsort der Mühseligen und Beladenen, der Enttäuschten und Verfolgten gewesen zu sein. Ebenso wie alle anderen Länder boten die USA mit der Mär von den unendlichen Möglichkeiten die Tragödie einer tief verdrängten Schuld und Grausamkeit.
Man meint ein freudianisches Muster zu erkennen, die Ambivalenz:
Gehaßt wird, was einen aufwachsen ließ, prägte und schützte. Reflex darauf ist eine Art Vatermord an dem, was die eigene Identität entstehen ließ und ausmacht. Das alles soll jetzt in Selbsttherapie abgeräumt werden.
Deshalb wird irrerweise überall Rassismus gewittert, deshalb gilt der weiße Mann als per se schuldig, der schwarze als unschuldig, deshalb fallen die alten Denkmäler, deshalb wird Literatur nach neuerdings als mißliebig empfundenen Worten und Aussagen durchkämmt und „achtsam“ umformuliert, also politisch korrekt verbastelt. Plötzlich wird eine Scham befohlen, aus der heraus etwas geheilt werden soll, was nicht mehr zu heilen ist.
Political Correctness, als Woke 1.0 ein dem Unbehagen an der eigenen Geschichte folgendes Verfahren, radikalisierte sich zur aggressiven Wokeneß, mit deren Hintergrund – McCarthy von links – eine Art moralischer Inquisition eingesetzt wird. Die kodifiziert ein völlig illusionäres Menschenbild, dem zwar niemand je entsprechen kann, das aber um so mehr verklärt und angebet wird, zum Fetisch erhoben und zum Ziel aller Bekenntnisse.
Mag sein, Triebkraft dieser Zwangsneurose ist zudem die Angst – herrührend aus der zutreffenden Erkenntnis, daß die sogenannte Wachstumsgesellschaft, der sich der erreichte Standard verdankt, die Ökosphäre verschleißt, die Artenvielfalt vernichtet, das Klima verändert und die Welt nicht nur landschaftlich, sondern ästhetisch verödet. Dennoch wollen die bislang hegemonialen linksliberal-woken Kräfte selbst ja am allerwenigsten mit dem Wohlstandsversprechen und ihrem unmäßigen Hedonismus brechen. Zurückhaltung und Verzicht ist für sie unvorstellbar. Sie bedürfen der Exponentialgesellschaft, die sie kritisieren.
Nicht zu vergessen: „Links“ sind mitnichten die Arbeiter und Angestellten, nicht die Handwerker und Dienstleister, ebensowenig das Prekariat, „links“ ist das Neubürgertum in den Villen der Gründerzeitviertel, so „links“ wie der Mann im Schloß Bellevue.
Je spürbarer die geringen Möglichkeiten, den Widerspruch zwischen Sendungsbewußtsein und Wirklichkeit auszugleichen, um so lauter die Agitatoren. Die von ihnen neu vermittelten Illusionen erweisen sich allgemein links anschlußfähig, weil nun – im Zuge der Wokeneß – auch die alte, sich nunmehr verjüngende Linke von gerechter Gesellschaft und neuem Menschen weiterträumen darf. Dem folgen wie stets die quengelnden Sozialvereine, die bräsigen Gewerkschaften und sowieso die staatstreue Lehrerschaft.
Woken Ideen und Umsteuerungen wirken auf ihre Anhänger schon deswegen erotisch, weil die sich mit ihren Legenden selbst als hochmoralisch, als kraft tiefer Einsichten geläuterter und besserer Teil der Menschheit ansehen dürfen. Das korrespondiert mit dem von Eltern wie Schule anerzogenen Narzißmus und dem exhibitionistischen Bedürfnis nach performativen Akten. Kaum jemand verkörpert das derzeit so eindrucksvoll wie Heidi Reichinnek, die damit ihrerseits zum Idol avanciert.
Helmuth Plessner diagnostiziert in „Grenzen der Gemeinschaft” (1924):
Der soziale Radikalismus sucht die Wärme des Verschmelzens und verkennt die Kälte der Distanz, in der allein Freiheit möglich ist.
Daher das Hohelied auf Gerechtigkeit, auf Teilhabe, auf allumfassende Inklusion und Empathie, daher die dummdreist-rührselige Propaganda von Gleichstellung und Antidiskriminierung. Endlich, endlich, so die frohe Botschaft, wäre der Mensch ganz bei sich selbst angekommen, endlich hätte er die notwendigen tiefen Einsichten in sein Geschick und könne nun final alle Konsequenzen aus dem angeblichen Fehlverlauf der jahrtausendelangen Vorgeschichte ziehen.
In trivialisierter Form schreibt woke Politik also die Aufklärung, Hegel, und Marx fort und kann selbst die vergreisenden Achtundsechziger noch trösten. Man zählt wieder zu den Guten, wenn man nur laut kreischend wie die „Omas gegen Rechts“ die Bösen identifiziert, ohne sich zu fragen, aus welcher Richtung die eigentlich kommen, denn an sich dürfte es sie im Ergebnis der intensiven politischen Umerziehung gar nicht mehr geben. Nur gibt es eben Ursachen und gleichfalls Rechtfertigungen für Korrekturen, die nur von rechts erfolgen können.
Weil die politische Rechte an Einfluß gewann und weil sie gegenwärtig ganz notwendig die Initiative hat, wird sie von den linken Stagnations- und Beharrungskräften um so mehr als verworfen, als krank, als abartig, als politpervers, als nazistisch markiert, steht sie doch einem Heil entgegen, das Illusionisten wiedermal greifbar schien und nicht von Dissidenten und Ungläubigen verdorben werden sollte.
Kritik gegen das Schaffen schöner neuer Welten, Mahnungen, der Mensch wäre auf so simple Weise ur-gut eben nicht, man habe ihn vielmehr in den Grenzen seiner Möglichkeiten und stets gefährdet von eigenen Abgründen zu sehen, kamen historisch immer von rechts und waren früher religiös grundiert und konservativ verfaßt.
Weil der radikale Konservatismus als fortwährende Mahnung aber stört, weil sein politischer Stoßtrupp, die Rechte, den Utopismus von Gerechtigkeitsillusionismus und sozialökologischem Glückseligkeitsfanatismus kränkt, sollen diese Kräfte ausgeschaltet werden. Deswegen gegenwärtig die gesamtgesellschaftliche Mobilisierung gegen Rechts. Andererseits ist etwa die CDU dort erfolgreich, wo sie mindestens widerwillig Aufgaben zu bearbeiten versucht, die die Rechte formulierte.
Dem woken Establishment intellektuell, literarisch, essayistisch zu begegnen erscheint schwierig. Eine Heilslehre ist Einwänden kaum zugänglich. Dennoch erfahren rechte publizistische Gegengewichte wie an diesem Ort Zuspruch, dennoch gibt es Renegaten, die die Seiten zu wechseln bereit sind – Mathias Brodkorb mag dafür ein Beispiel sein.
Sezessionisten sind reaktionär, das heißt, sie reagieren auf Herausforderungen. Bevor man nach der Legitimation des Trumpismus oder der AfD fragt, sollte gefragt werden:
Welche politischen und damit gleichfalls ökonomischen, sozialen und kulturellen Ursachen sind es, die ein Korrektiv nicht nur herausfordern, sondern ganz notwendig und zwangsläufig entstehen lassen. Die dramatischen Phasen des zwanzigsten Jahrhunderts lohnen genau diesbezüglich einer genauen Betrachtung, belehren aber gleichfalls darüber, wohin eine Polarisierung führt, die gegenwärtig eben nicht von rechts, sondern eindrucksvoll von links ausgeht.
Damit nicht ganz Wesentliches fehlläuft, mußte die Stunde der vermeintlich Bösen gegen die vermeintlich Guten schlagen.
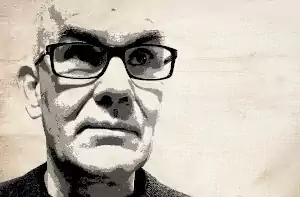
Rheinlaender
Was den Begriff der "Reaktion" angeht, halte ich die Definition Davilas für passender: "Der Reaktionär ist nicht der nostalgische Träumer abgeschaffter Vergangenheiten, sondern der Jäger heiliger Schatten auf den ewigen Hügeln." Der Reaktionär ist zur Kontemplation fähig und kann jenseits dieser Welt existierende Urbilder schauen, aus denen sich seine Vorstellung speist, oder er meint dies zumindest. Er unterscheidet sich m.E. sowohl vom linken, liberalen und rechten Utopisten, dessen Vorstellungen auf rationaler Abstraktion beruhen, als auch vom Konservativen, der nur auf den von anderen vorangetriebenen Wandel reagiert, sowie vom Technokraten, für den das effiziente Funktionieren der Gesellschaft im Rahmen von durch ihm nicht reflektierten Zielvorstellungen im Vordergrund steht. Da aber jede Vorstellung von sozialer Ordnung am Ende funktionieren muss, muss der Reaktionär echte Kontemplation von bloßem Wunschdenken unterscheiden können und ist zudem auf die Unterstützung von Technokraten angewiesen, wenn er mehr will als nur schöne Texte schreiben.